mein schwindender respekt vor der brandeins
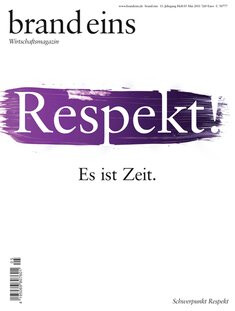
Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift brand eins hat sich das Thema “Respekt” gegeben und behandelt unter diesem Dach auch die Frage des geistigen Eigentums. Der Text “Geklaut bleibt geklaut” von Thomas Ramge ist online nicht verfügbar. Im Heft trägt er den Untertitel “Musik, Filme – und jetzt Bücher: Im Internet gilt geistiges Eigentum wenig. Autoren und Verlage beginnen sich zu wehren. Mit guten juristischen und ökonomischen Argumenten”
In dem Text, der sich selbst als “kurze Geschichte der Online-Piraterie” beschreibt, kommen Verlagsvertreter ebenso zu Wort wie zum Beispiel Philipp Otto von iRights.info und Robin Meyer-Lucht von carta.info.Trotzdem hinterlässt er mich ratlos. [quelle]
mich macht der brandeins-text ein bisschen wütend. nicht weil er eindeutig tendenziös geschrieben wurde, sondern weil er so schlecht geschrieben ist und vor logischen fehlschlüssen nur so trotzt (siehe weiter unten).
äusserlich gibt sich der text journalistisch einwandfrei. alle relevanten seiten werden gehört und zitiert, wertungen werden vornehmlich in zitaten ausgesprochen und auf den ersten blick wirkt es, als seien alle wichtigen aspekte zum thema zumindest einmal kurz und relativ objektiv angeleuchtet worden.
ramge hat aber so viele aspekte und gedanken der diskussion um „geistiges eigentum“ und „raubkopieren“ ausgelassen, dass man sich unweigerlich fragt: ist der so blöd oder steckt da kalkül dahinter? beides wäre ärgerlich.
zum thema flattr, zitiert ramge den „vorwärts“-redakteur karsten wenzlaff, profitierten vor allem diejenigen, „die populistisch polarisieren“. kein wort über tim pritlove. die flattr-erfahrungen der taz werden nur am rande erwähnt.
kein wort zum brasilianischen autor paul coelho, der „raubkopien“ seiner eigenen werke ins internet stellt und damit nach eigenen worten mehr bücher verkauft.
kein wort dazu, was autoren wie neil gaiman zur thematik sagen.
keine erwähnung von wissenschaftlichen erkenntnissen, die nahelegen, dass die abwesenheit von urheberrechten durchaus zu einem blühenden verlagswesen führen kann.
keine erwähnung davon, dass moderne „wissensarbeiter“, wie ramge durchgehend all diejenigen nennt die von urheberrechtsverletzungen geschädigt werden, auf den schultern von giganten (und zwergen) stehen und deren erkenntinisse natürlich auch kostenlos nutzen.
keine erwähnung, nicht mal ansatzweise, von der remix-feindlichkeit — und damit auch kultur-feindlichkeit — des modernen urheberrechts, bzw. das man selbst arrivierte wissensarbeiter künstler als „kopisten“ bezeichnen müsste, wenn man sich mit der materie eingehend beschäftigt.
das alles ist deshalb ärgerlich, weil ich lieblos zusammengeflanschte und tendenziöse müll-artikel zum urheberrecht überall lesen und sehen kann, von der brandeins aber einen ticken mehr erwarte. das so viele gute argumente oder gute gründe zur differenzierung in ramges artikel einfach ausgeblendet werden ist nicht mal das ärgerlichste. ärgerlich ist, dass die argumente für das klassische urheberrecht die der artikel bringt so schwach und so ausgelutscht sind. das mag daran liegen, dass diese argumente vornehmlich von der verlagsleiterin des campus-verlages kommen, die natürlich keinen spass daran hat, über alternative, neue oder innovative geschäftmodelle oder moderne, zeitgemässe formen des urheberrechts nachzudenken. für sie hört bei der durchsetzung von urheberrechten der spass auf, „spätestens wenn ein Geschäftsmodell dahintersteht“. klar. wer ein pferd nach dem auto befragt, bekommt vor allem argumente für kutschen zu hören.
zitat von annette anton, aus dem letzten absatz von ramges artikel, quasi das schlusswort:
Selbst wenn diese Betreiber und Nutzer von Tauschbörsen hundertmal behaupten, sie hätten große Hochachtung vor der kreativen Leistung der Autoren.
„Respekt drücke ich aus, indem ich für eine Leistung bezahle. Alles andere ist dämliches Geschwätz.“
das ist äusserst befauerlich, denn so kann frau anton weder künstler wie picasso, rubens, michelangelo oder homer „respektieren“. deren leistung kann sie nun mal nicht bezahlen. auch der respekt den thomas ramge frau anton oder phillipp otto oder robin meyer-lucht oder jeff jarvis entgegenbringt muss minimal sein. denn bezahlt hat der sie für ihre statements sicher nicht.
auch ich verliere langsam aber sicher meinen respekt gegenüber der brandeins. nicht weil ich in ihr meinungen lese, die nicht mit meinen übereinstimmen, sondern weil diese artikel zunehmend oft handwerklich miserabel gemacht sind (siehe auch slaven marinovic über google).
in drei bis vier wochen wird thomas ramges text kostenlos verfügbar auf brandeins.de stehen. dann wird aus einem schlechten text (nach annette antons logik) „dämliches Geschwätz“.
thomas ramge zitiert für eine huffington-post-fundamental-kritik spiegel online:
Die Huffington Post hat die Methode perfektioniert, aus interessanten Artikeln irgendwo da draußen im Web ein interessantes Detail zu extrahieren, daraus einen Kurzartikel samt Link zur Originalquelle zu schmieden und das Ganze mit einer möglichst klick- und suchmaschinenoptimierten Überschrift zu versehen.
einerseits ist das natürlich eine ziemliche respektlosigkeit, diesen text der von den „wissensarbeitern“ christian stöcker und conrad lischka gezeichnet ist (cis/lis), ohne deren leistung zu bezahlen und ohne deren namen zu nennen zu verwursten. abgesehen davon ist genau das nunmal das geschäft von journalisten, in der regel extrahieren journalisten eben interessante details oder gedanken aus anderen quellen — allerdings meist ohne link zur originalquelle.
nichts gegen spiegel-online, aber wenn man sich allein die ausbeute einer einzigen woche ansieht, in der spiegel-online artikel-details aus der los angeles times oder vom klatsch-portal tmz extrahiert, daraus einen kurzartikel ohne link zur originalquelle klöppelt und das ganze mit einer möglichst klick- und suchmaschinenoptimierten überschrift versieht, dann fragt man sich: was wollten uns ramge, stöcker und lischka nochmal genau sagen?
genau: journalismus ist (auch) praktiziertes parasitentum mit noblem anstrich und professioneller fassade.
am erschütternsten finde ich die krude logik vom ramge an dieser stelle:
So kursieren jeden Sonntagnachmittag auf den einschlägigen Filesharing-Plattformen App-Versionen des am Montag erscheinenden Nachrichtenmagazins »Der Spiegel« — bei denen sich die Kopisten auch noch die Mühe gemacht haben, die Werbung zu entfernen. Sie bekämpfen also nicht nur das Urheberrecht, sondern auch ein Geschäftsmodell, das immerhin dazu führt, dass das Magazin für Käufer erschwinglich wird.
witz nummer eins ist: spiegel online macht das im print-spiegel-archiv genauso (zufällig ausgewählte PDF-datei aus dem spiegel-archiv). wenn der print-spiegel nach einer oder zwei wochen ins (kostenlose) archiv wandert, wird die werbung entfernt.
witz nummer zwei wäre es, wenn ramge wirklich glaubte, dass anzeigen in einer „raubkopierten“ app-version des aktuellen spiegel, das heft für käufer erschwinglicher machen würde. den verlust von einnahmen wegen „raub-apps“ könnte man ja noch diskutieren, aber einnahmeverluste wegen fehlender werbung in „raub-apps“? och. mensch. das ist eine logik, die in baumschulen gelehrt wird.
es heisst ja immer, auch in ramges artikel, dass mit flattr oder anderen spendenmodellen und mit alternativen verwertungsmethoden immer nur einige wenige, herausragende „wissensarbeiter“ und künstler ein stetiges einkommen generieren könnten — und das die gratiskultur denen die lebensgrundlage entziehen würde. ich frage mich dann immer: gab es vor dem internet, vor der angeblichen gratiskultur, eigentlich nur gut bezahlte intellektuelle und künstler? musste in den guten alten analogen tagen kein autor hungern, kein musiker um seine tantiemen fürchten? oder waren es auch da einige wenige, herausragende menschen, die von ihrem wissen, ihren worten, ihrer musik oder ihrer kunst leben konnten?
[nachtrag 25.05.2011]
ich hab mal präzsisiert. nein gelobt. die chefredakteurin.
[nachtrag 28.05.2011]
der artikel von thomas ramge ist mittlerweile online verfügbar .