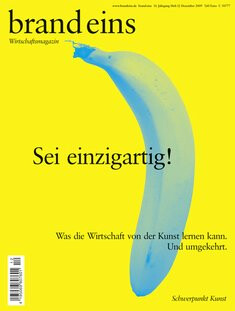kunst
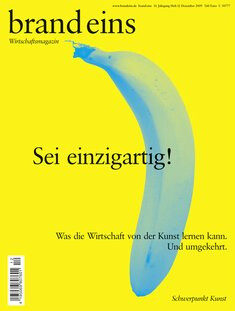
hervorragender text von wolfgang ullrich in der aktuellen brandeins über eine der zentralen funktionen der kunst: macht- und überlegenheitsdemonstration. (text leider noch nicht online)
So wurden etwa am Hof von Franz I. in den 1530er Jahren Künstler damit beauftragt, vieldeutige und verschlüsselte Werke zu schaffen. Besucher sollten gezielt intellektuell überfordert werden. Und so war es das Priveileg des Königs, seine Kunstschätze zu interpretieren, um auf diese Weise seine Überlegenheit zu beweisen und seine herausgehobene Stellung zu rechtfertigen.
[…]
Anstrengende Kunst ruft bei Außenstehenden Unterlegenheitsgefühlte hervor — und lässt dafür denjenigen, der sich damit umgibt umso cooler und stärker erscheinen. […] Auf diese Weise werden rätselhafte Kunstwerke zu Siegeszeichen und exklusiven Trophäen: zu Beweisen dafür, dass der Sammler ein herausragendes Maß an Stärke und Vitalität besitzt. (quelle)
das bringt die crux vieler spielarten der kunst auf den punkt. kunst ist in vielen fällen ein geschickt inszeniertes psychospielchen, das die reichen und mächtigen stützt und sich damit selbst hochjazzt.
andererseits ist es natürlich toll, dass es sachen gibt, die einen verwirren oder nicht auf den ersten blick verständlich sind und einen zur auseinandersetzung reizen. man darf sich nur nicht von kunst nervös machen lassen oder gar dem irrglauben verfallen, der künstler oder der sammler sei einem überlegen. meist ist das gegenteil der fall.
mein persönlicher zugang zu kunst ist übrigens releativ einfach und auch für den rest des lebens ganz hilfreich: ich kann ganz gut damit leben, bestimmte sachen nicht zu verstehen. oder andersrum: zu meinen, man müsse alles um einen herum verstehen, macht einen mit sicherheit fertig. auch hilfreich: sich vor augen führen, dass vieles was man anfangs nicht versteht, im nachhinein profan und primitiv ist — hat man es erstmal verstanden. dreisatz ist so ein beispiel. wer es nicht kapiert staunt bauklötze über leute die damit prozentzahlen ausrechnen können. wer es einmal kapiert hat, erkennt wie primitiv und einfach es ist.
und apropos hochjazzen. vor ein paar wochen lief auf arte die dokumentation „Die Millionenblase — Zerplatzte Träume am Kunstmarkt“. darin zeigt ben lewis wie die preise und hype-blasen im kunstmarkt enstehen. auf arte kann man es nicht mehr sehen, dafür aber (noch?) auf youtube. auch in der aktuellen ausgabe der brandeins wird das thema von peter laudenbach aufgegriffen und wunderbar auf den punkt gebracht. wie der text von wolfgang ullrich ist auch der von peter laudenbach noch nicht online. es lohnt sich wirklich (wie immer) das heft zu kaufen.
[lesenswert ist in diesem zusammenhang auch noch dieser text im freitag über damien hirst.]