Reiskocher helfen nicht beim Klimawandel (t3n 66)
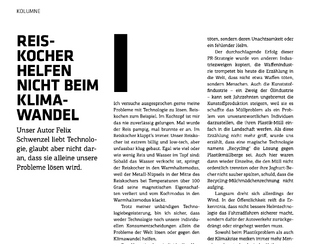
Ich versuche ausgesprochen gerne meine Probleme mit Technologie zu lösen. Reiskochen zum Beispiel. Im Kochtopf ist mir das nie zuverlässig gelungen. Mal wurde der Reis pampig, mal brannte er an. Im Reiskocher klappt’s immer. Unser Reiskocher ist extrem billig und low-tech, aber unfassbar klug gebaut. Egal wie viel oder wie wenig Reis und Wasser im Topf sind: Sobald das Wasser verkocht ist, springt der Reiskocher in den Warmhaltemodus, weil der Metall-Nüpsel in der Mitte des Reiskochers bei Temperaturen über 100 Grad seine magnetischen Eigenschaften verliert und vom Kochmodus in den Warmhaltemodus klackt.
Trotz meiner unbändigen Technologiebegeisterung bin ich sicher, dass weder Technologie noch unsere individuellen Konsumentscheidungen allein die Probleme der Welt lösen oder gegen den Klimawandel helfen.
Das Narrativ, dass individuelles Verhalten oder technologische Lösungen entscheidend bei der Lösung der Probleme der Welt sind, ist allerdings beliebt und weit verbreitet – auch dank unermüdlicher Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit der Industrie. Die Autoindustrie war bei dieser Art der PR erstmals vor 100 Jahren ein Vorreiter, um einerseits Regulierung abzuwenden und sich andererseits aus der Verantwortung für Verkehrstote herauszuwinden.
Das Konter-Narrativ der PR- und Lobby-Maschine der Autoindustrie lautete: Nicht Autos töten, sondern unvorsichtige Fußgänger seien für die sprunghaft gestiegenen Verkehrstoten verantwortlich. Statt per Gesetz den Autoverkehr einzuschränken, wurden zum Beispiel überall in Amerika Gesetze verabschiedet, die es verboten, Straßen zu überqueren – außer an Fußgängerüberwegen.
Das Narrativ wirkt bis heute. Statt zum Beispiel eine sichere Fahrradweg-Infrastruktur aufzubauen, veranstaltet das deutsche Verkehrsministerium Blendfeuerwerke, in denen die Nutzung von Sturzhelmen zur Erhöhung der Fahrrad-Sicherheit propagiert wird. So als ob es nicht Autos oder LKW seien, die Fahrradfahrer töten, sondern deren Unachtsamkeit oder ein fehlender Helm.
Der durchschlagende Erfolg dieser PR-Strategie wurde von anderen Industriezweigen kopiert: Die Waffenindustrie trompetet bis heute die Erzählung in die Welt, dass nicht etwa Waffen töten, sondern Menschen. Auch die Kunststoffindustrie – ein Zweig der Ölindustrie – kann seit Jahrzehnten ungebremst die Kunststoffproduktion steigern, weil sie es schaffte, das Müllproblem als ein Problem von unverantwortlichen Individuen darzustellen, die ihren Plastikmüll einfach in die Landschaft werfen. Als diese Erzählung nicht mehr griff, wurde uns erzählt, dass eine magische Technologie namens „Recycling“ die Lösung gegen Plastikmüllberge sei. Auch hier waren dann wieder Einzelne, die den Müll nicht ordentlich trennten oder ihre Joghurt-Becher nicht sauber spülten, schuld, dass die Recycling-Milchmädchenrechnung nicht aufging.
Langsam dreht sich allerdings der Wind. In der Öffentlichkeit reift die Erkenntnis, dass nicht bessere Helmtechnologie das Fahrradfahren sicherer macht, sondern dass dafür der Autoverkehr zurückgedrängt oder eingehegt werden muss.
Sowohl beim Plastikproblem als auch der Klimakrise merken immer mehr Menschen, dass technologische Heilsversprechen oder individuelle Konsumentscheidungen allein nicht helfen, sondern nur entschlossene politische Entscheidungen – und grundlegende gesellschaftliche Veränderungen.
Technologie hat uns jahrhundertelang das Leben bequemer und sicherer gemacht – und das Reiskochen erleichtert – aber auch viele der Probleme, die wir jetzt haben, überhaupt erst beschert. So sehr ich an der Hoffnung festhalten möchte, dass Technologie bei der Lösung meiner und der Probleme der Welt helfen könnte, so sicher bin ich auch, dass Technologie alleine nicht helfen wird. Wichtiger dürfte sein, dass wir uns stärker politisieren, nicht mehr von den PR-Narrativen der Industrie aus dem Tritt bringen lassen und die Heilsversprechen der Technologie skeptischer betrachten.
Anders gesagt, frei nach Kennedy: „Frage nicht, was du oder Technologie gegen den Klimawandel tun können, sondern was dein Land gegen den Klimawandel tun kann.“