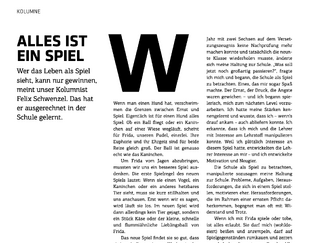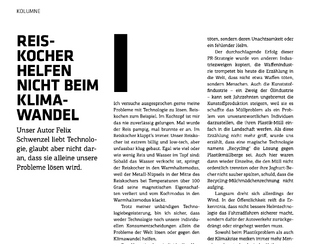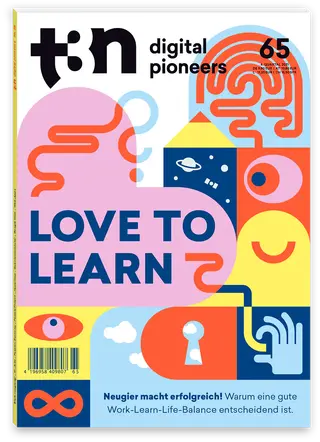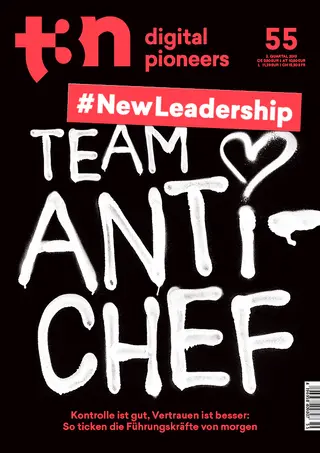Mach es selbst! (t3n 75)

In Bologna isst man keine Spaghetti Bolognese. Das Ragù alla Bolognese wird in Bologna ausschließlich mit Tagliatelle serviert — und zwar am besten frisch mit Ei gemacht, mit einer rauen Oberfläche, damit die Sauce sich appetitlich an die Nudeln schmiegt. Vielen Menschen sind solche Informationen wichtig. Sie wollen wissen, wie die einzig wahren Nudeln alla Bolognese herzustellen sind, oder wie man echtes Sushi, original Sachertorte oder traditionellen norddeutschen Labskaus macht. Ich finde solche Fragen hingegen völlig uninteressant. Interessant ist für mich zu verstehen, wie man es macht — um es dann selbst zu machen.
Deshalb halte ich auch nichts von Ernährungstipps: Beim Essen geht es nicht um richtig oder falsch oder gar um Perfektion, sondern ums Selbermachen. Und dieses Selbermachen, das Kochen, hat über die Zeit eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Seit ich mich für Zutaten und Rohstoffe und die Frage, was man daraus machen kann, interessiere, befinde ich mich in einer Art positiven, sich selbst verstärkenden Kreislauf. Aus ein bisschen Neugier wurde mit wachsender Erfahrung und vermehrten Erfolgserlebnissen irgendwann unbändige Neugier. Dass sich diese Neugier heutzutage dank Internet, Fernseh- und YouTube-Köchen und fantastischen Rezeptbüchern vortrefflich befriedigen lässt, verstärkt den positiven Kreislauf ums Essen immer mehr.
Der Witz dabei: Das gilt für alles, was man selbst macht. Es hört sich wie eine Binsenweisheit an (ist es wahrscheinlich auch), aber reiner Konsum befriedigt auf Dauer nicht — Selbermachen schon.
Selbermachen sieht von außen mühselig und anstrengend aus, aber von innen betrachtet ist es pure Selbstbefriedigung. Wer etwas selbst macht, erfährt und lernt zwangsläufig, wie die Dinge funktionieren und wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen. Dieser Neugierkreislauf belohnt – immer aufs Neue – mit Dingen, auf die man stolz sein kann, die man benutzen oder essen kann — und die man nicht nur auf Instagram teilen kann. Mit selbstgemachten Dingen verschafft man nicht nur sich selbst Glück, sondern auch anderen.
Das Tolle am Selbermachen ist auch das Staunen über sich selbst und über die Dinge, die man herzustellen in der Lage ist. Ich staune vor allem deshalb über mich selbst, weil mich selbst die unvermeidlichen Misserfolge nicht entmutigen oder ernsthaft frustrieren. Auch hier scheint ein positiver, sich selbst verstärkender Motivationskreislauf am Werk zu sein – weil die Erfahrung zeigt, dass irgendwann auch schwierigere Aufgaben klappen.
Zusätzlich erfüllen Kochen und Backen mich mit Stolz. Stolz, aus einfachen Dingen etwas Komplexes herstellen zu können – überhaupt Dinge herstellen zu können, die dann auch noch schmecken, schön anzusehen sind oder praktisch sind. Insbesondere das Backen mit Sauerteig wirkt wie Magie. Ich kann es jedes Mal kaum glauben, was man aus Wasser, Salz und Mehl zaubern kann.
Steve Jobs hat irgendwann einmal gesagt, wir sind hier, um kleine Dellen in der Welt zu hinterlassen. Neulinge kratzen Nachrichten auf ihren Schultisch oder an Klowände, um Dellen in der Welt zu hinterlassen, Profis wissen, dass selbstgemachte Nudeln, die man Freunden oder seinen Liebsten serviert, ebenfalls eine kleine Beule im Universum hinterlasen. Und die Dellen, die selbstgemachte Sauerteigbrote hinterlassen, duften auch noch köstlich. So sind Kochen und Selbermachen der beste Weg zur praktischen Weltverbesserung.