susanne gaschkes strategien gegen verdummung
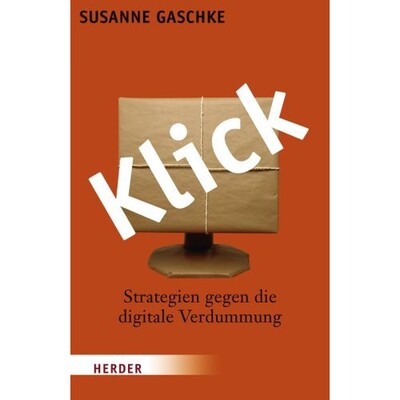
susanne gaschke mag das internet nicht. das ist nichts neues, wenn man schonmal über einen text von gaschke oder ihr autorenregister auf zeit.de gestolpert ist:
- Im Google-Wahn — Der Internetgigant kennt bald jeden unserer Schritte. Es ist Zeit, dass die demokratische Gesellschaft sich wehrt
- Im Netz der Piraten — Der Diebstahl geistigen Eigentums im Internet verletzt nicht nur die Rechte der Autoren, er bedroht auch unsere Kultur
- Die digitale Erlösungslehre — Das Internet formuliert die neue Verheißung des Kapitalismus: Grenzenloses Wissen, für alle, gratis? Lasst euch nicht verführen!
wenn man ihr buch liest, erfährt man, dass sie auch computerspiele, fernsehen, „konsumismus“, zeitverschwendung und „überflüssige kommunikation“ nicht mag. was sie mag sind bücher, literatur, kunst, musik und „erfahrungen mit sozialem engagement“.
„Ich glaube nicht, dass das Netz mehr Demokratie, klügere Wissenschaft, verantwortlicheren Journalismus und mehr soziale Gerechtigkeit hervorbringen wird. Und ich meine, einige Anhaltspunkte dafür zu haben, dass die digitale Kultur diesen Zielen an bestimmten Stellen sogar entgegensteht.“
noch weniger als das internet, mag gaschke allerdings die leute, die das internet gut finden. alle die das internet nicht entschieden ablehnen, nennt sie „Digitalisten“ oder „Internet-Apologeten“. sie wirft alle in einen topf: techniker, unternehmer, industrielle, blogger, twitterer, suchmaschinenoptimierer, netzpolitik-aktivisten, marketing-fuzzis, netzpolitik-aktivisten — selbst differenzierenden kritikern des internet oder seiner auswüchse unterstellt sie oppurtunismus oder konfliktscheu, wenn sie nicht, wie sie, das internet undifferenziert, klar und deutlich verurteilen. sie wirft alle zusammen in einen eimer mit der aufschrift „Digitalisten“. man muss sich nur mal vorstellen wer sich alles in diesem eimer wiederfindet, brin und page neben lawrence lessig, stefan niggemeier neben kai dieckmann, bill gates neben linus thorvald, barack obama neben angela merkel, jeff jarvis und hubert burda. alles „Digitalisten“.
gaschke ist nicht nur extrem undifferenziert, was das internet angeht, ihr ist auch nichts recht zu machen:
- einerseits beklagt sie die durchkommerzialisierung des netzes und seine aufdringlichen marketingstrategien, schimpft aber auch darüber, dass internet-kolumnisten („blogger“) ihre beiträge kostenlos, oder wie sie vieldeutig sagt, „umsonst“ ins internet stellen. „blogger“ nennt sie interessanterweise auch nicht „autoren“, sondern meist „nutzer“.
- einerseits beklagt sie, dass durch das internet und moderne „medien“ die literalität und fähigkeiten zu lesen abnehme, geisselt die im internet ablaufende schrift-kommunikation von menschen untereinander aber gerne als profane oder überflüssige „sinnloskommunikation“.
- einerseits beklagt sie die aggressivität und die determiniertheit der netzbefürworter („Digitalisten“) und welch verheerende folgen die erfolgreiche propagierung der netzideologie habe (sie sieht hier eine „Ideologiemaschine“ am werk), andererseits bezweifelt sie rundheraus, dass aus dem netz überhaupt etwas politisch wirksames kommen könne und behauptet, dass das netz entpolitisiere.
- einerseits beklagt sie sich über leute die geschichten aus ihrem leben mit anderen teilen („Wer sich in »sozialen Netzwerken« selbst weltöffentlich entblättert, ist nur eins: selber schuld.“), andererseits fordert sie, dass geschichten aus dem leben anderer die auf papier gedruckt sind („Bücher“) mehr gelesen werden sollten.
auf der anderen seite hat mir auch einiges von dem was sie schreibt auch ein kopfnicken abgerungen. wer würde einem satz wie diesem widersprechen?
Ich bin fest davon überzeugt, dass es keine zweite Fähigkeit gibt, die für das Zurechtkommen in modernen Gesellschaften so wichtig ist wie das flüssige, souveräne Lesen, Verstehen und Beurteilen von Texten.
„Leseförderung“, offenbart gaschke, sei eines der themen, das sie beruflich am meisten interessiere und für das sie sich in ihrem erwachsenenleben am meisten engagiert habe. auch das sieht man recht deutlich, wenn man die liste der artikel die sie in den letzten drei jahren für die zeit schrob kurz durchsieht (1, 2, 3, 4, 5, 6). natürlich hat sie recht; ohne lesen zu können, kann man auch nicht im internet lesen. ohne souveränität im umgang mit texten, wird das mit der urteilsfähigkeit und dem aufgeklärten, mündigen bürger schwierig.
allerdings behauptet gaschke steil, dass die „Digitalisten“ das anders sähen, bzw. lesefeindlich seien. einerseits weil die netzapologeten nicht (an)erkennen, dass es zwischen dem guten lesen (bücher, „die zeit“) und dem schlechten lesen (am bildschirm) eine konkurenzsituation besteht, also die neuen medien dem buch zeit und aufmerksamkeit entziehen. andererseits, weil die „Digitalisten“ mit ihrer forderung nach freiem und unlimitierten zugang zu informationen „die geistige Haltung für die ein gefülltes Bücherregal steht“ bekämpften: „die Bereitschaft Mühe auf sich zu nehmen, um Freude zu erlangen; eine Aufschub statt einer Sofortismuskultur.“ — und so das interesse am konzentrierten lesen und verstehen-wollen rapide abnehme.
im kern mag die analyse ja stimmen, auch wenn gaschkes überzeugungskraft stark darunter leidet, dass sie eine 13 jahre alte studie von jakob nielsen hervorkramt um zu belegen, dass niemand längere texte am bildschirm liest und ausser acht lässt, dass sich mittlerweile vieles verändert hat; webseiten sind lesbarer und lesefreundlicher geworden (siehe zeit.de), die bildschirme sind besser, flackerfreier, kleiner und hochauflösender geworden (vergleichen sie mal nen 17" röhrenmonitor mit dem bildschirm eines iphones oder eine palm pre. die sind mittlerweile so scharf, dass man millimetergrosse buchstaben lesen kann).
trotzdem. selbst wenn man gaschkes analyse folgt, fällt es schwer ihren schlussfolgerungen zu folgen. sie stellt fest, dass das interesse und die fähigkeit zu lesen abnehmen und fordert als konsequenz eine konzentration auf das medium papier? sie stellt fest, dass die konzentrationsfähigkeit beim lesen abnimmt und fordert als therapie eine zugangserschwerung oder verknappung von informationen?
der gesunde menschenverstand oder genauer, der gesellschaftliche konsens, den ich zu diesem thema bisher wahrnahm, fordert eine verbesserung des bildungssystems und eine schulung in medienkompetenz. „medienkompetz“ ist allerdings eines der reizwörter die gaschke in rage bringen. sie vermutet auch hinter der forderung nach mehr medienkompetenz ideologische motive der „Digitalisten“ und ihrer verdummungsstrategien. zumal natürlich auch die schulung zur medienkompentenz zeit und mühe kostet, die wiederum zu lasten des buches, der zeitung, der literatur und des wahren lebens („real life“ nennt gaschke das) gehen.
gaschkes analyse ist alles andere als widerspruchsfrei. so jubelte sie noch im oktober 2007 darüber, dass „wir dem Triumphzug eines Buches beiwohnen“ („Die Welt liest“) und beobachtet, wie „plötzlich […] allein in Deutschland Hunderttausende von Lesern, unter ihnen viele Jugendliche, in Kauf [nehmen], einen 1000-Seiten-Wälzer auf Englisch zu lesen.“ 2009 ist ihre analyse wieder vom pessimismus überdeckt und ihr harry-potter-jubel abgeflaut: „Bücher und Lesen verlieren an Popularität, und dies besonders bei Jugendlichen.“ schuld sind vor allem die netzapologeten, mit ihrer teuflischen ideologie der wissensgesellschaft.
könnte es nicht auch umgekehrt sein? verlieren „Bücher und Lesen“ vielleicht nicht deshalb leser an die digitalen medien, weil die jugendlichen sich nicht mehr mühen oder durch lange texte durchbeissen wollen, sondern weil die inhalte auf papier so schlecht geworden sind? ist die zeitungskrise nicht eher ein qualitätsproblem, als ein technologieproblem? warum lesen junge menschen rowling, aber nicht gaschke? ich war siebzehn, als ich neil postmans „wir amüsieren uns zu tode“ gelesen habe. wieso kann ich mir heute keinen siebzehnjährigen vorstellen der gaschkes „strategien gegen die digitale verdummung“ liest? richtig. weils kreuzöde und flach wie ein bügelbrett ist.
apropos bedürfnisse zurückhalten und mühe in kauf nehmen. stellen wir uns vor, gaschke würde die erfindung des kühlschranks oder der tiefkühltruhe mit der erhöhung des durchschnittlichen gewichts der einwohner westeuropas und nordamerikas in verbindung bringen. wahrscheinlich läge sie gar nicht so falsch damit, dass die sofortige befriedigung kulinarischer genüsse, die so ein kühlschrank ermöglicht, die leute dazu animiert mehr zu essen. wer mag noch die mühe auf sich nehmen, eine kuh zu melken, wenn er milch im kühlschrank stehen hat? nur: verfetten uns kühlschränke deshalb, so wie das internet „uns“ laut gaschke verblödet?
ich glaube der mensch ist lernfähig und anpassungsfähig. wir werden lernen die probleme die mit neuen technologien aufkommen (sei es ernährung, informationsüberflutung) in den griff zu bekommen, indem wir kulturtechniken entwickeln um die negativen folgen zu dämpfen. der umgang mit alkoholkonsum in der westlichen welt zeigt das exemplarisch. obwohl die negativen folgen des alkoholkonsums nicht zu leugnen sind, haben wir kulturtechniken und tabus entwickelt, um damit umzugehen. besser zumindest, als es die nordamerikanischen indianer können, in deren kultur alkoholkonsum nicht verankert war (und ist). alkoholkonsum ist so tief in unserer gesellschaft verankert, dass sogar die altehrwürdige, gesellschaftskritische wochenzeitung „die zeit“ der droge alkohol, die jährlich allein in deutschland ungefähr 40.000 menschen das leben kostet, breiten raum zur verherrlichung einräumt.
solche prozesse in der gemeinschaften mit gefahren und risiken umzugehen lernen dauern mitunter sehr lange, aber was ist die alternative? die zeit können wir nicht zurückschrauben, wir können weder alkohol, noch fertigessen, noch den freien fluss der informationen verbieten (bzw. wenn wir es versuchten, wären die negativen folgen vermutlich weitaus ausgeprägter als die positiven). wir können nur versuchen möglichst vernünftig mit neuen problemen („digitalisten“-sprech: „herausforderungen“) umzugehen.
„Typisch für den Diskurs über das Internet scheint mir zu sein, dass seine Protagonisten stets extrem überzeugt auftreten. Skeptiker hingegen sichern sich nach allen Seiten ab und betonen fast immer mit großem Aufwand, was an der neuen Technik selbstverständlich ganz ausgezeichnet ist, bevor sie (zaghafte) Kritik anbringen.“
gaschke mag pragmatische ansätze aber nicht. sie polemisiert, überspitzt und spaltet lieber: wer nicht gegen das internet ist, ist dafür, ist ein digitalist, ein ideologe. pragmatische und differenzierte betrachtungsweisen kanzelt gaschke als feige und oppurtunistisch ab. sie unterstellt differenzierenden kritikern des internets, dass sie nicht kulturpessimistisch oder altmodisch wirken wollen oder konfliktscheu seien.
gaschke gibt sich kampfeslustig und aggressiv. genau betrachtet ist gaschke aber gar nicht kampfeslustig. sie sehnt sich nur nach anerkennung. anerkennung für ihre lebensart, ihre haltung. sie möchte nicht mehr als kulturpessimist gesehen werden, sondern als prophetin. sie will um die deutungshoheit ringen, dafür kämpfen, „Technik benutzen zu dürfen, ohne sie anbeten zu müssen.“ nur, wer zwingt gaschke dazu, technik „anbeten zu müssen“? mann kann sich doch enthalten. man muss die neuen medien nicht lieben. und wenn man sie liebt, heisst das nicht, dass man ihnen völlig kritiklos gegenüberstehen müsste. ich vermute, sie will einfach ihre ruhe (und recht) haben, sie will das dieses geschnatter weggeht, dass ihre und die stimmen ihrer intellektuellen mitstreiter wieder da sind, wo sie hingehören: ganz oben, da wo die deutungshoheit und relevanz sie sanft umwehen. weg mit dem pöbel-geschnatter!
ich kann gaschke aber auch verstehen. wenn ich morgens im balzac sitze und am bildschirm hochphilosophische texte und emails lese, dann stört es schon, dass in dem laden jeder sprechen darf. teilweise bellen sogar hunde. jeder meint was zu sagen zu haben — in der öffentlichkeit! es ist anstrengend und es macht aggressiv, wenn man fremde, ungebetene meinungsäusserungen nicht einfach ausfiltern kann.
was ich aber nicht verstehe, ist gaschkes ablehnung von verfügbarmachung von wissen oder (genauer) informationen durch das netz. sie lehnt es ja nicht nur deshalb ab, weil die „Digitalisten“ information und wissen oft synonym benutzen, sondern weil allgegenwärtige information eine „Sofortismuskultur“ fördere. nur, was ist beispielsweise der unterschied zwischen der altertümlichen bibliothek von alexandria und dem internet heute? der hauptunterschied den ich erkenne ist, dass in alexandria das wissen der damaligen welt nur einigen wenigen priviligierten zur verfügung stand. und zwar — wie in jeder ordentlich geführten bibliothek — sofort, nur ein paar regale weiter, quasi „information at your fingertips“. im internet steht das wissen plötzlich allen zur verfügung. ob es sich alle anzueignen vermögen, ob alle etwas damit anzufangen vermögen, ist natürlich eine ganz andere frage, übrigens genau wie in einer bibliothek.
aber gaschke stört tatsächlich dass nun plötzlich alle zugriff haben. besonders für kinder sei es besonders schädlich, wenn es keine geheimnisse, keine tabus mehr gäbe. auch die erwachsenen würden durch die „Sofortismus-Kultur“ infantilisiert: „Der digital native aber will nicht ringen, er will klicken“. vermutlich rotiert neil postman angesichts solcher hausmacher-makramee-philosophie, die sich auch noch explizit auf ihn beruft, in seinem grabe.
apropos makramee-philosophie. ein gutes drittel ihres buches verwendet gaschke darauf, darzulegen wie schädlich, konzentrations-, lese- oder bildungsfeindlich das internet gerade für kinder und heranwachsende sei. dass auch sport, vor allem leistungssport, das potenzial hat jugendliche zu verblöden oder von einer umfassenen bildung im gaschke’schen klasischen sinne abhält, weiss jeder der schonmal sportler-interviews im fernsehen gesehen hat. die probleme des bildungssystems, meinetwegen auch, um es mal gaschkesque auszudrücken, die verblödungstendenzen unserer gesellschaft sind kein technologisches problem, genauso wie die lösung nicht rein technologisch möglich ist. niemand wird ernsthaft behaupten, dass fernseher oder computer kinder besser aufziehen können als engagierte eltern, die ihren kindern zeit und aufmerksamkeit und liebe schenken. (obwohl ich durchaus leute kenne, die die ersten 20 jahre ihres lebens vor dem fernseher verbracht haben und aus denen durchaus etwas respektables geworden ist.) die mischung machts und gaschke scheint die jugend für blöder zu halten als sie ist. jugendliche können sehr gut zwischen der angeblichen scheinwelt der sozialen netze im internet und denen im „wahren leben“ unterscheiden, ihr sensorium ist wahrscheinlich sehr viel ausgeprägter als gaschke es ihnen zutraut. es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass „das Internet keine negativen Auswirkungen auf die Sozialbeziehungen von Jugendlichen hat – sondern positive“. aber selbst wenn gaschke recht hätte und das internet, oder die modernen medien, nicht förderlich für die entwicklung von jugendlichen sind, wieso soll eine gesellschaft, frei nach mark twain, kein steak essen, nur weil babies es nicht kauen können?
aber gaschke unterschätzt nicht nur die jugendlichen, sondern auch die internetnutzer. für sie sind das alles hirnlose und vereinsamte auf-den-bildschirm-glotzer, die einer scheinwelt erliegen. die positiven folgen die die vernetzung von menschen (und informationen) hat, blendet gaschke einfach aus. schlimmer noch, sie nimmt sie gar nicht wahr. wäre ihr buch eine restaurantkritik, wäre es die erste restaurant-kritik, die ohne das betreten des besprochenen restaurants entstanden wäre. sie hätte dann zwar mit den gästen vor der tür geredet, tagelang das geschehen durch die fenster beobachtet und unzählige bücher und untersuchungen von restaurant-kritikern zitiert, aber selbst im restaurant gegessen hätte sie nicht. sie hätte all die erfahrungen die sie an imbissständen, gulaschkanonen oder ihrer eigenen küche gemacht hätte in ihr buch einfliessen lassen, aber ihr urteil durch einen eigenen, intensiven restaurantbesuch trüben lassen, das hätte sie wohl nicht gewollt.
„[Politik braucht] Nähe, Begegnung, Streit, Diskussion; die Erfahrung, leibhaftig für ein Anliegen zu kämpfen, bei Abstimmungen zu unterliegen, gewählt oder nicht gewählt zu werden, Rücksicht zu nehmen, Kompromisse zu schließen. Das ist eine ganzheitliche Erfahrung, die echter Menschen bedarf, die einander kennen. Sie kann online unterstützt und ergänzt werden, aber niemals ersetzt werden.“
anders kann ich mir zumindest nicht erklären, warum sie die kultur die an vielen ecken und enden des internets wächst und gedeiht nicht wahrnimmt oder eben nicht als kultur anerkennt, warum sie soziale netzwerke im internet als unpersönliche, oberflächliche „Ersatz-Gemeinschaften“ bezeichnet und steif und fest behauptet, das netz entpolitisiere. meine erfahrungen zeigen das gegenteil. wir haben es im internet nicht nur mit maschinen zu tun, sondern auch mit menschen. vor allem das social-web könnte, nein, bringt bereits völlig neue kultur-techniken zutage. natürlich gibt es schund und schrott und abzocker und scharlatane und idioten und perverse und doofe im internet. so wie das in jeder zeitungsredaktion, stadt oder auch schule ist. allerdings behaupten deshalb nur ganz wenige, dass zeitungen, städte oder schulen uns deshalb verblödeten.
aber: gaschkes buch hat meine wahrnehmung verändert. neuerdings erwische ich mich manchmal beim lesen eines längeren textes am bildschirm, wie ich plötzlich das interesse am text verliere. ich denke dann an gaschke und ihre these, dass man bildschirm nicht ordentlich lesen könne, reisse mich zusammen und lese trotzig den text zuende. später fällt mir dann manchmal auf, dass mir das ebenso oft mit zeitungen oder büchern passiert. entweder bin ich schon total verblödet oder gaschke hat es tatsächlich geschafft meine aufmerksamkeit zu schärfen.
[nachtrag]
ein paar 2009er-rezensionen zu gaschkes buch bei buecher.de.