max schrems, kämpf um deine daten
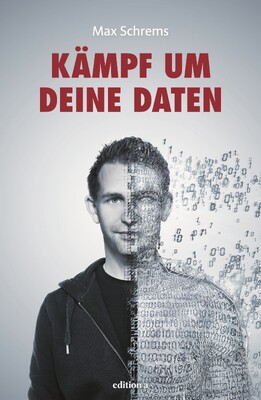
max schrems ist zu etwas berühmtheit gelangt, weil er einer der ersten menschen der welt war, der facebook nervte (zitat sz):
Der Mann, der Facebook nervt
Der Österreicher Max Schrems wollte wissen, welche Informationen Facebook über ihn speichert - und löste damit das größte Datenschutzverfahren in der Geschichte des Unternehmens aus. (auf sueddeuschte.de lesen)
in einer der letzten wochen kam sein buch mit dem titel „kämpf um deine daten“ raus. ich habs kostenlos zugeschickt bekommen und gelesen.
der verlag sieht das buch wie folgt:
Jetzt legt der Student mit der Gabe, den Datenwahnsinn so einfach zu erklären wie Jamie Oliver das Kochen, sein Wissen und seine Erfahrungen aus erster Hand als Buch vor.
Ohne Panikmache und mit ungebrochener Lust an Technologie, erklärt er, wie Konzerne ihre Kunden durchleuchten, auch ohne dass die ihre Daten angeben.
uwe ebbinghaus ist in der faz vom „Erzähltalent“ schrems begeistert und fand die art und weise, in der schrems „die Mythen der IT-Industrie“ durchleuchte „ein intellektuelles Vergnügen“.
ich bin da in meinem meinungsbild eher gespalten. weder erklärt schrems den „Datenwahnsinn“ einfach, noch verzichtet er auf panikmache, noch ist die lektüre des buches ein „intellektuelles Vergnügen“.
schrems quält sich und seine leser in den ersten hundertfünfzig seiten an der frage ab, warum privatshäre „doch etwas wert“ sei. eigentlich müsse man das ja gar nicht erklären, sagt er in der einleitung, aber er hätte da „einige Elemente, Hintergründe und Gedanken, die auch für bereits Überzeugte interessant sein könnten“. leider fehlt es diesen elementen und hintergründen teilweise an argumenten, interessanz und differenziertheit. natürlich ist das nicht alles quatsch, was schrems da zusammengetragen hat, aber so richtig rund ist das buch eben auch nicht.
am sauersten ist mir tatsächlich aufgestossen, dass max schrems nirgendwo klar definiert was er eigentlich mit „meinen daten“ meint, für die ich kämpfen soll. auch um den begriff der privatsphäre dribbelt er ständig herum und landet dann irgendwann auch bei der geistlosen und wenig hilfreichen analogie von privatsphäre und dem unbeobachteten benutzen der toilette.
das mit der definition (oder problematisierung des begriffs) von daten hat jürgen geuter (auch anlässlich des buchs von schrems) hier aufgeschrieben: „Wem gehört mein digitaler Zwillig?“
apropos definitionen; auch witzig, dass ausgerechnet sergey brin kürzlich eine sehr kompakte, brauchtbare definition von privatsphäre geliefert hat: die erwartung das dinge die man geheimhalten möchte, auch geheim bleiben.
was an den ersten 150 seiten neben der begriffsunschärfe und vielen ungenauigkeiten besonders nervt, ist das undifferenzierte überspitzen, das schrems zu allem überfluss auch noch mit flapsigkeit und sarkasmus würzt.
[Es gibt] immer noch Nutzer, die Unmengen an persönlichen Daten offen ins Netz stellen. Die meisten von ihnen sind meiner Beobachtung nach aber vor allem süchtig nach menschlicher Zuneigung, ausgedrückt in Likes, Retweets und Kommentaren. Die Designer dieser Dienste sprechen hier von einer »positiven Nutzererfahrung«. Die Stimmlage erinnert dabei oft an Drogenhändler […].
bei solchen abschnitten, in denen arroganz und verachtung bei schrems durchscheint, habe ich mich immer wieder gefragt, warum (offenbar) niemand das manustript gegengelesen und korrigiert hat. möglicherweise sind solche absätze auch köder für papier-feuilletonisten wie ebbinghaus, die in solchen absätzen dann ihr intellektuelles vergnügen finden und das buch positiv rezensieren. ich finde solche passagen vor allem überflüssig und der sache nicht dienlich. benutzer als dämliches klickvieh, dass sich von der industrie mit „roten Zuckerln“ in „Pawlowsche Hunde“ verwandeln lässt oder in „total willenlose Zombies“ findet max schrems dann nach vier, fünf seiten wortschwall auch irgendwie „überspitzt“ und relativiert seine beschimpfungen dann als anregung zum „überdenken“.
auch die paternalistisch angehauchte panikmache in sachen filterblasen kommt nicht zu kurz:
[D]ie Algorithmen [schneiden] jene Seiten weg, die Sie selten lesen. Politik? Weg damit! Sie blättern eh immer nur darüber. Dafür gibts jetzt 25 Seiten Sport und Chronik. Wenn Sie glauben, jeder bekommt die gleichen Ergebnisse bei Google, die gleichen Updates bei Facebook oder die gleichen Vorschläge bei Amazon, dann liegen Sie falsch. Es wird alles anhand Ihrer Daten gefiltert und angepasst. […] Andere Meinungen und neue Dinge, für die wir uns bis dato nicht interessiert haben, werden weggefiltert. Demokratiepolitisch ein Wahnsinn.
ein wahnsinn, wie schwierig es ist ein differenziertes buch zu schreiben, in dem andere meinungen und neue dinge nicht einfach weggefiltert werden. noch schwerer ist es natürlich ein buch zu schreiben, in dem man bei einer meinung bleibt:
auf seite 88 erzählt schrems wie nutzlos anonymisierung und pseudonymisierung von benutzerdaten ist und zählt mehrere beispiele auf, wie man aus ano- oder pseudonymisierten daten auf identäten zurückschliessen kann. unter anderem erzählt er von der berühmten AOL-datenspende vor acht jahren, aus der sich (natürlich) zahlreiche persönliche daten rekonstruieren liessen.
auf seite 194 schlägt schrems dann plötzlich im kapitel „was tun?“, bzw. „Privacy by Design“ vor, künftig einfach „viele Daten auch anonymisiert oder zumindest pseudonymisiert zu speichern“, um sie zu schützen.
auf seite 94 behauptet schrems, dass auf der seite des ORF „keine Daten der Nutzer“ gesammelt werden:
Jedenfalls funktioniert das, wie bei den meisten klassischen Webseiten, ohne irgendwelche Überwachung und Datensammelei.
das stimmt eben auch nur so halb. die vier externen tracker die beim aufruf von orf.at aufgerufen werden, sammeln nach eigenen angaben anonyme („Ad Views, Browser Information, Hardware/Software Type, Interaction Data , Page Views“) und pseudonyme („IP Address (EU PII)“) daten, die sie wiederum auch mit dritten teilen (xaxis) oder nicht sagen ob sie das tun (adition, meetrics, owa). so oder so preisen sich sowohl adition, als auch xaxis dafür an, targeting, also personalisierte, auf datensammelei basierende werbung anzubieten.
zugegebenermassen findet das „Ausspähen für Werbeklicks“ (zitat uwe ebbinghaus) beim ORF in geringerem umfang als auf vielen anderen werbefinanzierten nachrichtenseiten statt, aber zu behaupten, die meisten klassischen webseiten funktionierten ohne „irgendwelche Überwachung und Datensammelei“ ist quatsch. zumal schrems am ende des buches seinen lesern auch explizit „Plug Ins für […] Browser“ (schreibweise schrems) empfiehlt, „die Tracking so weit wie möglich unterbinden“. also plugins wie ghostery oder donottrackme oder disconnect oder priv3.
die ungenauigkeiten, die fehler, die auslassungen, der unwillen zu differenzieren und bindestriche zu benutzen macht die ersten zwei teile des buches wirklich schwer und unvergnüglich zu lesen. natürlich stimmt vieles was schrems sagt, das eine oder andere ist sogar ganz interessant, aber für ein buch reicht das nicht. oder besser: hätte jemand das buch um mindestens die hälfte eingedampft, ein paar fehler rauskorrigiert und schrems dazu gedrängt sich auf das konkrete zu konzentrieren, hätte das ein lesenswertes buch werden können. (wenn ich, ausgerechnet ich, übermässig viele fehler finde, ist das immer ein ganz schlechtes zeichen. CO² mit hochgestellter zwei schreiben? „Lösungsfristen“?)
denn wenn schrems über die juristischen und fiskalen tricks von facebook redet, die hilflosigkeit des gesetzgebers, der datenschützer und die absurditäten des europäischen rechts beschreibt, liest sich das buch ganz gut. auch seine konkreten vorschläge am ende des buches, was einzelne, was alle tun könnten, wo auswege zu finden sein könnten, sind anregend und beinahe inspirirend.
kurz vor ende schreibt schrems im kapitel „Bewusstseinsbildung“:
Ein großes Problem ist dabei, dass wir von sehr abstrakten, nicht greifbaren Problemen sprechen. Wie mich der östereichische Fersehmoderator treffend fragte: »Wie filmen Sie Datenschutz? Wie zeigen Sie verlorene Freiheit? Wie werden solche abstrakten Begriffe für den Durchschnittsnutzer sichtbar?« Die Vermittlung dieser Probleme braucht viel Aufwand, viel Können und Engagement.
an aufwand und engagement fehlt es schrems jedenfalls nicht.