Lernen will gelernt sein (t3n 53)
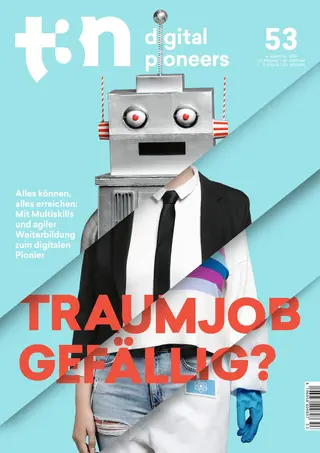
Ich war lange Zeit ein lausiger Schüler, weil ich die Schule nicht als einen Ort erkannte, in dem ich lernen kann, sondern als einen Ort, in dem ich lernen muss. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich bemerkte, dass das Angebot, das mir die Schule machte, Türen und Potenziale öffnet – Türen zu Erkenntnissen und Fähigkeiten, die ich für Dinge gebrauchen konnte, die mich wirklich interessieren. Der winzige Wahrnehmungsunterschied zwischen Lernen-Müssen und Lernen-Können verwandelte mich von einem miesen Schüler in einen ganz passablen: Mit konkreten Zielen vor Augen machte es mir plötzlich Spaß, zu lernen.
Kinder erkennen die Vorteile des Lernens intuitiv. Man kann ihnen nicht beibringen, zu sprechen. Sie fangen von selbst damit an – weil sie mitreden können wollen. Durch Beobachtung, Wiederholung und Übung erarbeiten sie sich wichtige Grundlagen der Grammatik und der Semantik. Sie bringen sich jahrelang alles, wirklich alles, selbst bei – einzig und allein durch Zuschauen, Zuhören und mutiges, dilettantisches Nachmachen. Alles, was sie dafür brauchen, sind Vorbilder: Personen in ihrem Umfeld, denen sie nacheifern können.
Niemand kommt auf die Idee, (gesunde) Kinder im Laufen, Reden oder Argumentieren schulen zu wollen. Auf die Idee, Menschen zu „schulen“ kommt man erst, wenn sie ungefähr sechs Jahre alt sind – und dann sollen sie lebenslang Wissen und Wissensgrundlagen vermittelt bekommen.
Vielleicht lernen Menschen in Bildungseinrichtungen nicht, weil man ihnen Lehrstoff zuführt, sondern weil diese Orte Menschen ein Umfeld bieten, in dem sie lernen können – wenn sie wollen. Wenn es gut läuft, aktivieren Bildungseinrichtungen durch Vorbilder auch einen Sog zum Lernen. Der Sohn meiner Schwägerin bewunderte seine lispelnde Lehrerin so sehr, dass er plötzlich auch anfing zu lispeln. Trotzdem gibt es einen Mangel an sichtbaren bildungsnahen Vorbildern, die zum Lernen-Wollen und Lernen-Können inspirieren. In der Unterhaltung und im Sport mangelt es kaum an solchen Vorbildern.
Wer YouTube-Stars nacheifern will, kann sich ohne große Einstiegshürde daran versuchen. Wer sich vorstellen kann, ein Spiel, eine App, eine Website oder einen Kampfroboter zu bauen, merkt schnell, dass mathematisches Grundwissen und der Umgang mit Programmiersprachen den Weg dorthin ebnen. Wer sich im Netz nicht gerne belügen, aufhetzen oder verarschen lassen will, erkennt, dass Medienkompetenz immunisieren kann. Und wer ein Ersatzteil 3D-drucken möchte, sieht, dass Geometriekenntnisse sehr hilfreich sind.
Um Ziele zu erreichen, braucht es nicht nur Motivation, sondern auch Aneignungs- und Filterkompetenzen. Lernen zu lernen ist neben der Motivation der schwierigste Schritt auf dem Weg zu Bildung und ständiger Neugier. Genau dieses Lernen-Wollen und -Können sind wichtige Voraussetzungen für Medien- und Digitalkompetenz. Bildung muss man sich – wie Freiheit – nehmen. Die gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit liegt in den Händen jedes Einzelnen. Aber die Gesellschaft muss auch Anregung, Raum und Mittel zum Lernen bereitstellen.
Wir alle müssen in uns selbst und in anderen wieder kindliche Neugier wecken. Wir müssen weg vom konsumorientierten „das will ich haben“ hin zu einem lernorientierten „das will ich auch können“. Es klingt absurd, aber wer von Qualifizierungsoffensiven oder digitaler Transformation spricht, muss in gewisser Weise auch von Infantilisierung sprechen.
diese kolumne erschien zuerst in der t3n 53 im august 2018 und hier: mehr infantilität wagen!