Zweifel (t3n 52)
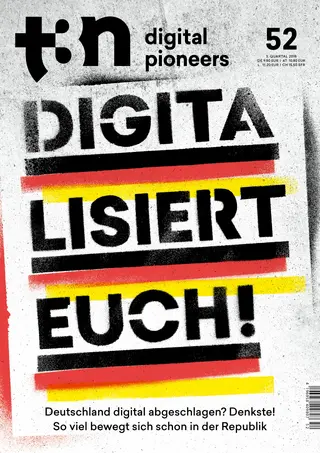
Den Deutschen wird oft (zu Recht) vorgeworfen, zögerlich zu sein. Die Zögerlichkeit bei der Adaption neuer Technologien, Risikoscheu, Regulierungswut oder bürokratische Hürden beim Gründen sehen viele Menschen — auch dieses Heft — eher kritisch. Dass diese deutsche Angst aber durchaus ihre positiven Seiten hat, zeigte zum Beispiel der zweite Golfkrieg. Deutsche Politiker zeigten sich angesichts des gesellschaftlichen Klimas zögerlich, der Aufforderung George W. Bushs nachzukommen, sich an dieser kriegerischen Auseinandersetzung zu beteiligen. Als Donald Rumsfeld 2003 auf der Münchener Sicherheitskonferenz für den Angriff auf den Irak warb, entgegnete ihm Joschka Fischer: „Excuse me, I am not convinced!“. Im Saal gab es kaum Applaus für Fischers Zweifel. Aber die Aussage spiegelte die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland ziemlich exakt wieder.
Zögerlichkeit, kritische Distanz und Zweifel haben ihre Berechtigung und Sinn. Der Zweifel hat im 18ten Jahrhundert die Aufklärung in Gang gebracht, ein politisches System ohne eine starke, an der Weisheit der Regierenden zweifelnde Opposition neigt zum Autoritären, ein Rechtssystem ohne Zweifel wäre drakonisch. Spätestens in diesem Jahr haben auch die euphorischsten Internet- und Vernetzungsapologeten (ich bin selbst einer) gemerkt, dass nicht alles, was Unternehmer mit neuen digitalen Werkzeugen machen und ermöglichen auch automatisch der Weltverbesserung dient.
Zweifeln ist konstruktiv, solange die Zweifel nicht angstbasiert sind und man den Zweifel, die Skepsis, mit Neugier, Offenheit und und Lust am Diskurs kombiniert. Wenn wir an der Sinnhaftigkeit militärischer Interventionen eines unserer mächtigsten Alliierten und Handelspartners zweifeln können und das vorbehaltlose Mitmachen verweigern, warum sollten wir nicht auch die digitalen Innovationen und deren Sinnhaftigkeit gelegentlich in Frage stellen?
Voltaire, einer der herausragenden Köpfe der Aufklärung, der den Zweifel laut Wikipedia „zu einer Maxime seines Denkens“ machte, sagte: „Zweifel ist zwar kein angenehmer geistiger Zustand, aber Gewissheit ist ein lächerlicher.“
Die Gewissheit, mit der viele, auch ich, die Digitalisierung mit positiven Folgen in Verbindung brachten, wirkt auf mich im Nachhinein tatsächlich ein bisschen lächerlich. Ich habe viele Jahre (mit Gewissheit) daran geglaubt, dass die Digitalisierung, die Vernetzung und niedrigschwellige, leicht zugängliche und grenzenlose Kommunikation vor allem positive gesellschaftliche Auswirkungen haben würde. Die vergangenen Jahre haben aber gezeigt, dass auch Demagogen, autoritäre Regierungen, Geheimdienste oder Unternehmen die Digitalisierung zu ihrem Vorteil ausnutzen können und das auch hemmungslos tun.
Die diffuse German Angst, die deutsche Zögerlichkeit kann man auch positiv betrachten. Gut begründete Zweifel, Vorbehalte, eine gewisse Langsamkeit, die einem auch Zeit zum Nach- und Durchdenken gibt, ist nicht gleichbedeutend mit Verweigerung.
Ich wünsche mir (auch von mir selbst) künftig mehr gesunden Zweifel in der Digitalpolitik und der vernetzten Welt. Die negativen Folgen der ungezügelten Digitalisierung, der unregulierten (kommerziellen und politischen) Datensammelei sind bereits so offensichtlich, dass selbst Mark Zuckerberg inzwischen öffentlich die Notwendigkeit von Regulierung einräumt — wenn sie „vernünftig“ sei.
So wie die Politik langsam erkennt, dass das Internet, die Vernetzung der Welt, die Digitalisierung nicht mehr weggeht, merken Unternehmer wie Mark Zuckerberg, dass Regulierung, auch unternehmerisch schmerzhafte Regulierung, unausweichlich in immer mehr Bereichen ansetzen wird und ausausweichlich ist.
Wir, die wir in dieser digitalisierten und vernetzen Welt leben wollen (und müssen), sollten allerdings nicht den Politikern und Unternehmern das Aushandeln dieser Regulierungen allein überlassen. Nicht nur weil sich Politiker gerne eher von Wirtschaftsinteressen als vom Gemeinwohl lenken lassen oder sich gerne von Unternehmern um den Finger wickeln lassen. Vor allem, weil wir die kritische Auseinandersetzung mit digitalen Technologien sowohl kritisch, als auch konstruktiv von innen heraus führen müssen. Euphorie, Neugier und Offenheit lassen sich durchaus mit Zweifel kombinieren. Kombinieren wir den Zweifel mit Angst, oder ist Angst das einzige Triebmittel des Zweifels, driftet der Zweifel in die Verweigerung. Schaffen wir es nicht die Euphorie gegenüber neuen Technologien mit Zweifeln und kritischem Hinterfragen zu kombinieren, laufen wir Gefahr uns lächerlich zu machen.