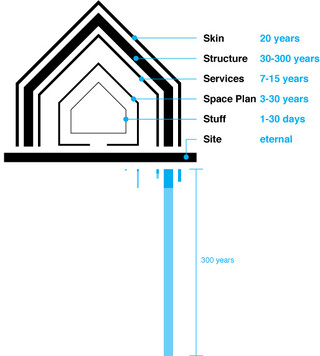next11, tag 2
heute am zweiten tag der next viele vorträge gesehen und auch einige gute.
fabio sergio hatte eine sehr, sehr hübsche präsentation von der mir leider nicht sehr viel in erinnerung geblieben ist. unter anderem ein zitat von henry ford:
If I’d asked customers what they wanted, they would have said „a faster horse“.
während seines vortrags bin ich gedanklich etwas abgedriftet und habe erneut über die thesen von kevin slavin nachdenken müssen. ist es nicht in der welt allgemein und gerade im internet speziell so, dass alle entwicklungen, seien es gute oder schlechte, gegenreaktionen auslösen? wie in der physik: actio et reaction. auf spam folgen spamfilter, auf DRM folgen cracks, auf viren folgen virusfilter, auf datenschützer folgen spacken, auf spacken aluhüte. und, so unangenehm oder um mal das buzzword der letzten vier next-konferenzen zu benutzen, so disruptiv all diese entwicklungen sein mögen, sind sie nicht vielleicht auch fortschrittstreiber? viren sind auch ziemlich unangenehm und sie haben viele menschen das leben gekostet, aber es gibt auch theorien, dass sie allen menschen auch erst das leben geschenkt haben könnten, dass sie ein wichtiger teil der evolution waren, weil sie DNA-bruchstücke von einer spezies zur anderen tragen konnten?
ich glaube, wir sollten viele entwicklungen in der welt, bzw. im internet gelassener betrachten. klar sind die kostenlos-geschäftsmodelle im internet vor allem darauf ausgerichtet unsere daten zu (werbe-) geld zu machen und unsere aktiva auszubeuten. johan staël von holsten warnte uns lauthals vor dieser, wie er es ausdrückte, modernen form der sklaverei und schrie uns vom podium entgegen: „trust nobody!“ möglicherweise, warnte er, würden die chinesen eines tages facebook kaufen — und dann gute nacht. um seine glaubwürdigkeit zu unterstreichen, erzählte er uns, dass er erst mit 26 lesen gelernt habe und worte bildlich wahrnehmen würde. und weil er bildlich denken könne, sei er eben ein visionär. aber natürlich ist er auch ein geschäftsmann und wollte auf sein projekt mycube.com hinweisen. dort seien unsere daten sicher. warum wir ihm trauen sollten, vergass er allerdings zu erwähnen.
wir brauchen diejenigen, die unsere daten missbrauchen, uns unfair behandeln, grenzen des anstands überschreiten um sich einen goldenen arsch zu verdienen (siehe auch stichwort „samwer-brüder“) um zu erkennen, dass man daten missbrauchen kann, dass es anstandsgrenzen braucht — und nur so können wir die gegenthesen entwickeln und gegenmassnahmen ergreifen — oder eben auf gegenbewegungen warten, die so sicher wie das amen in der kirche — jedesmal — kommen.
uwe lübbermann von premium cola trat mit angeschnalltem rucksack auf die bühne (das sei sein büro) und erzählte, dass er nicht primär getränke verkaufen wolle, sondern die welt verändern und daten schützen wolle, beziehungsweise, auch andere getränkehersteller dazu bringen wolle, die daten die sie nichts angehen oder an die sie unrechtmässig gekommen seien, nicht zu verwenden. cola, getränke und datenschutz. das ist mal ein USP.

was julia schramm sagte war glaube ich ziemlich egal. ich habe aber auch nicht verstanden, auf was sie eigentlich hinauswollte.
james hilton von AKQA war laut und ein unerträglicher angeber. möglicherweise hat seine agentur tolle projekte gemacht, wovon ich aber nichts erfuhr, weil ich den saal verliess.
nach der pause habe ich mich in den werbefuzzi-track gesetzt, weil florian steps von vodafone über vodafones reise zu hölle und zurück erzählen wollte („To Hell and Back — the Vodafone Brand in the Digital Age“). leider kann florian steps kein englisch („we went some sort to hell, but the good is we went back“) und auch wenn er am ende behauptete, dass vodafone aus den fehlern der vergangenen „social media“-kampagnen gelernt hat, stellte er den verlauf der vodafone „generation upload“-kampagne als serie kleinster fehler dar. und überhaupt, sei der shitstorm auf das internet beschränkt gewesen und nicht in die wirkliche welt geschwappt. also eigentlich sei nichts passiert, zumal ja immer nur die wenigen lauten und destruktiven elemente gehört werden („a few reactions from se community“).
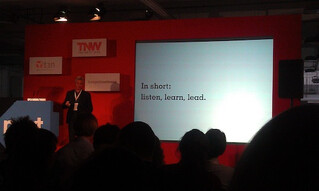
immerhin habe vodafone jetzt gelernt, dass man erst zuhören müsse, bevor man seine werbebotschaften anderen in die ohren schreit, dass es gut ist auf reaktionen vorbereitet zu sein und auch mal zu antworten, statt zu schweigen, wenn man in den dialog mit nutzern treten möchte und dass man nicht mehr versprechen solle, als man halten kann. für normale menschen selbstverständlichkeiten, für vodafone was ganz neues. glückwunsch!
sehr geschickt der auftritt von michael trautmann von kempertrautman. die masche muss man sich wirklich merken. sein auftritt war werberuntypisch demütig, zurückhaltend, bescheiden, aber deutlich und zielgerichtet. er stellte drei charity-projekte von kempertrautmann vor, beschrieb sie kurz und sachlich um dann mit kleinen, vorbereiteten filmchen pathosstürme aufs publikum zu schiessen und die schmutzige, emotionale tränendrüsen-arbeit von seinen filmen erledigen zu lassen. analog zur „bad cop and good cop“-methode hat michael („meikel“) trautmann eine präsentationsmethode erfunden, in der ein zurückhaltender, distinguierter werber und ein pathetischer, aufgedrehter freak-werber auftreten — und man trotzdem nur den graumelierten, distinguierten werber vor sich sieht. respekt!
von jochen adler habe ich gelernt, dass die deutsche bank eingentlich „deutsche bänk“ heisst und mit welchen widerständen und widrigen umständen er bei der einführung eines intranet-twitter-clons zu kämpfen hat. ich fand das deshalb sympathisch, weil er ein sehr angenehmens englisch sprach, bescheiden auftrat und glaubhaft seine euphorie beim backen von kleinen brötchen rüberbrachte.

mehrere highlights dann im letzten track des tages, einmal russell davies, der über das internet der dinge, beziehungsweise darüber sprach, wie man mit kleinen technischen spielereien das internet vom bildschirm und in die welt bringt. er zeigte tolle (kleine) projekte die demonstrierten welche spannenden potenziale darin stecken, das internet in objekte — und weg vom bildschirm — zu bringen. auch sehr hübsch wie er seinen vortrag einleitete: mit der pompös-grössenwahnsinnigen 20th-century-tata-tata-tata-melodie und dem kleinen wort „hello!“ als sie zuende war.
ebenso unterhaltsam, aber ein bisschen weniger visionär und kreativ danach rafi haladijan, der erfinder des nabaztag (violet, den nabaztag-hersteller hat er mittlerweile verkauft) und jetziger betreiber von sen.se. er stellte sich folgendermassen vor: „i’m french, therefore i will make this presentation in bad english.“ sein vortrag war etwas holprig und in schlechtem englisch, nichtsdestotrotz sehr unterhaltsam, auch wenn er die meisten gags bereits vor 2 jahren auf der next brachte, als er violet vorstellte.
einen grossartigen tumblr-blog-tipp hatte er auch dabei fuckyeahinternetfridge.tumblr.com: ein denkmal für die zweitblödeste technische wunschvorstellung der welt: den internet-verbundenen kühlschrank (kommt direkt nach der videotelefonie).

der letzte vortrag von der hochschwangeren sarah lacy war zuerst wegen einer überdosis pathoseuphorie und grundlosem lächeln schwer gewöhnungsbedürftig, stellte sich aber dann im verlauf der 20 minuten vortrag als eines, wenn nicht das highlight der next heraus. sarah lacy berichtete über ihre reise und ihre erfahrungen mit startups und unternehmen in den sogenannten entwicklungsländern. und das was sie erzählte war einerseits extrem spannend, andererseits sehr rührend aber vor allem liess es nur einen schluss zu (den sarah lacy so nie ausdrücken würde): wir im westen sind so voll mit überheblichkeit und gefühlter überlegenheit, dass wir blind und unfähig sind, die wahren probleme, aber auch die grossartigenkeiten und ungeheuren potenziale in den entwicklungsländern zu erkennen. ihr vortrag hatte einen sehr optimistischen beigeschmack und war völlig frei von der üblichen shock-and-awe-strategie, die man sonst hört, wenn von der künftigen wirtschaftlichen überlegenheit der (noch) entwicklungsländer wie china oder indien oder diversen afrikanischen staaten gesprochen wird. ein bisschen zuviel euphorie — aber extrem inspirierend.
und noch ein buch auf meiner wunschliste.
[nachtrag 18.05.2011, 22:30]
ein paar korrekturen und umformulierungen eingebaut (was natürlich nicht heisst, der text sei jetzt fehlerfrei). ausserdem noch der hinweis auf ein video, das russell davies in seinem vortrag zeigte, das sehr lustig ist und das in deutschland leider nicht verfügbar ist.