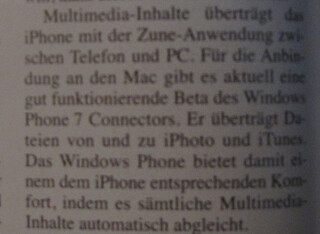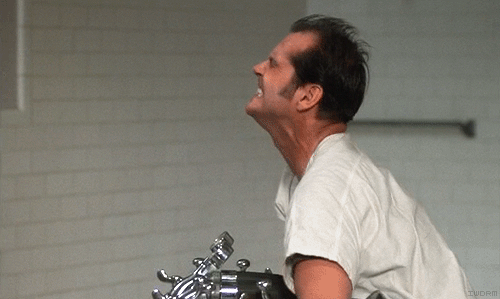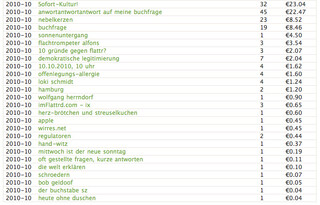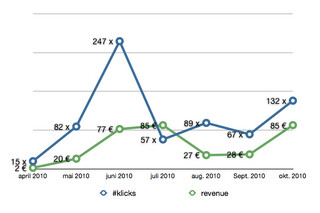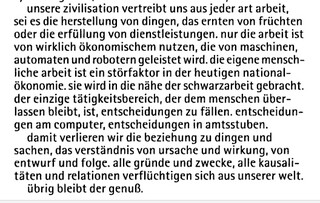irgendwann mal habe ich gesagt, dass die „blogosphäre“ eine der wenigen gruppen ist, zu der ich mich jemals zughörig erklären würde, weil sie so unfassbar heterogen ist:
„die blogger“ sind die erste gruppe der ich mich freiwillig als mitglied zuordnen lasse, auch weil sie so wunderbar heterogen sind. […] ähnliche grupppen, äusserst heterogen und unfassbar, sind zum beispiel „autoren“, „wichser“, „männer“, „arbeitende“, „denkende“ oder „fernsehgucker“. (fast allen) diesen grupppen schliesse ich mich ähnlich unbekümmert an wie der der „blogger“.
die heterogenität einer gruppe schliesst selbstverständlich mit ein, dass sie auch arschlöcher beinhaltet. das haben gruppen so an sich. schwierig wirds für mich immer genau dann, wenn die arschlöcher anfangen zu schreien und regeln für alle anderen in der gruppe aufstellen wollen. anständige deutsche machen dies und das nicht. echte männer kritisieren sich nicht öffentlich, sondern trinken miteinander bier. anständige SPDler nehmen keine beraterjobs in der wirtschaft an. anständige blogger machen keine werbung, journalisten können nicht bloggen.
alle paar jahre kommen sie aus ihren löchern gekrochen, die regelaufsteller-arschlöcher, faseln von leitkulturen, datenschutzrichtlinien oder unabdingbaren rechten die blogkommentatoren angeblich zu gewähren seien. die rechte von blogkommentatoren die aufgeregt eingefordert werden, variieren zwischen: alle kommentare sind freizuschalten (sonst sei das zensur!), kommentarfunktionen sind grundsätzlich anzubieten (sonst sei das ding kein blog!) hin zu einem ganz neuen dogma, dass die anonymität eines jeden blogkommentators zu wahren sei (sonst sei das bild-zeitungs-niveau!) oder alternativ, dass störende kommentare einfach stillschweigend zu löschen seien (weil alles andere nur provoziere oder der profilierung des blogbetreibers diene).
das ärgerliche an den regelaufsteller-arschlöchern ist, dass sie meist nicht argumentieren oder vom einzelfall ausgehen, sondern dogmen aufstellen. wo ist der unterschied, zwischen einem politker der von „leitkultur“ oder „überfremdung“ faselt und bloggern die behaupten, journalisten könnten keine echten blogger sein? die argumentationsmuster zumindest sind die gleichen: ideologisch, misanthrop, populistisch und meist arschlochig. arschlochig vor allem auch deshalb, weil dogmen keine argumente sind (über die man diskutieren könnte), sondern eben lehrsätze.
das besonders unangenehme an den dogmatikern ist, dass sie für ihre kurzfristigen ziele hysterie provozieren und von den eigentlichen problemen und missständen ablenken. oft geschieht das sogar ohne absicht, aber mit derselben abstumpfenden wirkung. nichts gegen den schockwellenreiter, er ist nur eines von vielen beispielen die ich wählen könnte, aber ich nehme ihn mal wegen des geringen schwierigkeitsgrades als beispiel: ist mal jemandem aufgefallen wie oft der schockwellenreiter „zensur!“ schreit? gefühlt 300 mal pro jahr und tatsächlich ziemlich oft. jeden kleinschiss, bei jeder privatfehde oder editwar oder im müll gelandetem leserbrief (oder kommentar) „zensur“ zu schreien vernebelt die wahrnehmung und trivialisiert das eigentliche problem. oder anders gesagt: wenn man bei über jedem scheiss „zensur“ schreit, fällts schwer sich über echte zensur zu empören — oder sie überhaupt noch als solche zu erkennen.
das gleiche prinzip wenden politiker gerne an — auch wenn da oft eine prise mehr berechnung hintersteckt. wenn sie beispielsweise von einem verfassungsmässigen grundrecht der bürger auf freiheit und sicherheit reden, gefährdungen hochhysterisieren, seien es gesundheitsgefahren oder terroristen, vernebeln sie ebenso wie aufgeregtes zensurgeschrei die wahrnehmung und trivialisieren das eigentliche thema. schlimmer noch, die ursprüngliche streitfrage wird aus dem wahrnehmungsfeld geschoben. denn das fundamentale problem — und das zeigt nicht nur die geschichte — ist ein staat der seinen bürgern keine sicherheit und freiheit vor dem staat garantiert (mehr dazu hab ich mal hier vor zwei jahren geschrieben).
ebenso trivialisiert man die gefahren denen die wahrung der persönlichkeitsrechte oder der privatssphäre in unserer gesellschaft ausgesetzt sind, wenn man stefan niggemeier in der diskussion um das sogenannte „konstantingate“ vorwirft mit bild-methoden vorzugehen oder ein ominöses recht auf anonymität verletzt zu haben oder verbrechen gegen den datenschutz begangen zu haben. ich finde durchaus, dass stefan niggemeiers vorgehen zu kritisieren ist, aber einfach mit der grossen prinzipienkeule draufzuhauen, sich ein paar lehrsätze aus der nase zu ziehen, einen verstoss gegen diese dogmen zusammenreimen und dann die verlorene ehre des stefan niggemeiers zu proklamieren ist voll aigner.
die macht das nach dem gleichen muster. ängste oder unsicherheiten aufspüren, diese ängste aufblasen, ohne interesse an details diese unsicherheiten aufputschen und mit der prinzipienkeule einfach überall draufhauen. so hat das wunderbar bei der google street-view- oder facebook-diskussion funktioniert. am ende standen auf allen seiten hysterische diskutanten, die der gegenseite entweder verantwortungslosigkeit, unkenntnis, dummheit — oder hysterie vorwarfen. inmitten dieses nebelkerzen-meeres, lassen sich jetzt prima schaufenster-gesetze verabschieden, die — wie die diskussion — niemandem helfen und kein einziges problem lösen — ausser das problem von aigners vorheriger profillosigkeit.
und das ist das eigentlich widerliche an der diskussion um „konstantingate“, aber auch an vielen aspekten der politik (oder in teilen, natürlich nur exemplarisch, an nico lumma): kein interesse an details, hintergründen oder den dingen hinter dem augenschein aufbringen, dogmatisch und laut schreiend mit der prinzipienkeule draufhauen und dann scheinheilig allgemeingültige regeln oder gesetze fordern.
da könnte man echt internet-, politik und weltverdrossen zugleich werden.
abgesehen davon, eine abschliessende meinung habe ich dazu auch nicht. eigentlich zu gar nix.