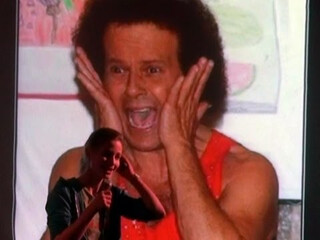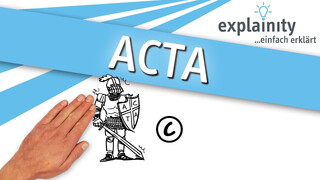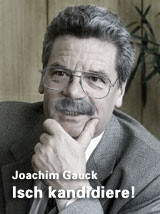leistungsschutz?
ich gebe zu, ich lese spiegel online gerne. die seite ist voll mit müll, aber es gibt auch sehr viele artikel die mit journalistischer leidenschaft geschrieben oder originell sind und einen guten überblick über die nachrichtenlage geben. ich lese spiegel online fast täglich und ärgere mich trotzdem nur alle 3 oder 4 tage.
als ich dann heute bei spiegel-online diesen artikel („Brandbrief von Goldman-Sachs-Manager — Die Abrechnung“) auf der startseite sah und anklickte, las ich natürlich erstmal das original („Why I Am Leaving Goldman Sachs“, lobenswerterweise prominent von spon verlinkt. [nachtrag 02:40h] für einen link auf diesen the-daily-mash-artikel der später erwähnt wird reichts dann aber schon nicht mehr). durchaus lesenswert, aber halt englisch und ausser 214 kommentaren drunter ohne weiteren kontext.
danach habe ich den spon-artikel gelesen. er bot tatsächlich ein bisschen einordnung, leider etwas arg naheligend („Der Brandbrief sorgte in den USA und Großbritannien prompt für eine Masse an Kommentaren.“). na gut es folgen noch zwei absätze mit zitaten zur einordnung:
"Jeder an der Wall Street hat das gelesen", sagt Erik Schatzker, Moderator beim Wirtschaftssender Bloomberg TV. Seine Kollegin Sara Eisen ergänzt: "Es ist ein Desaster für Goldman Sachs."
In Internetforen, Blogs und auf Twitter wird fleißig über die Bank gespottet. Der Blog "Business Insider" nennt den Abschiedsbrief von Smith "einen weiteren PR-Albtraum" für Goldman. Die britische Webseite "The Daily Mash" veröffentlichte bereits eine Satire: "Warum ich das Imperium verlasse, von Darth Vader".
der rest des artikels belässt es dabei teile des „brandbriefs“ zu zitieren, grossenteils in indirekter rede. was hat spiegel-online also genau getan?
einen absatz geschrieben in dem steht, dass jemand einen brief schrob. ein absatz in dem zusammengefasst steht was in dem brief stand. einen absatz mit einer platitüde („viele reaktionen“) und zwei zitaten von fernsehjournalisten. ein absatz mit weiteren reaktionen. drei absätze übersetzte zitate aus dem brief. ein absatz in dem eine sprecherin von goldman sachs zitiert wird. ein absatz mit einer einschätzung der lage von goldman sachs, wahrscheinlich aus presseagenturmeldungen rausgeschnipselt und ein weiterer absatz mit zitaten aus dem brief.
das soll jetzt keine kritik oder ein text über den spiegelverlag werden, ich finde den spon-brief-agentur-mashup total OK. tägliches journalistisches handwerk („was machst du beruflich?“ „zusammentragen und zusammenstückeln.“).
faszinierend finde ich nur, dass verleger heutzutage für soetwas einen besonderen schutz zu beanspruchen versuchen. die arbeit von zusammenträgern und zusammenstücklern soll nach ansicht der verlage (die mit soetwas hoffen werbung besser verkaufen zu können) von einem „leistungsschutzrecht“ gedeckt werden. die verlage meinen, dass niemand anders ausser ihnen selbst mit solchem patchwork geld verdienen dürfe. das leistungsschutzrecht soll auch für „journalistische inhalte“ gelten, die zu 90 prozent aus zusammengeklauten zusammengetragenen material bestehen. die verleger selbst bezahlen (ausser den nachrichtenagenturen und dem zusammenstücklern autoren) niemanden und bedienen sich freizügig an den inhalten anderer. wenn ihnen das selbst passiert, nennen sie es oft diebstahl oder unrechtmässige kommerzielle nutzung und wollen lizenzgebühren dafür sehen.
mir scheint es absurd, lizenzgebühren für etwas zu verlangen, für das man selbst keine lizenzgebühren zu zahlen bereit ist. vielleicht können wir über das leistunsgschutzrecht nochmal reden, wenn verlage für interviews (also das absaugen von geistigem eigentum aus interviewpartnern), tweets des tages auf dem titelblatt oder paraphrasierungen von fremden inhalten (aus zeitungen, büchern, fernsehen oder blogs) lizenzgebühren oder honorare zahlen.
zumal ordentliche journalistische arbeit heutzutage ja auch bei einer veröffentlichung im internet durch das urheberrecht geschützt ist. auch wenn die verlage auch das sehr eigennützig und selbstverliebt auslegen.
matthias spielkamp stellt sich im handelsblatt ähnliche fragen, allerdings um einiges eleganter als ix.