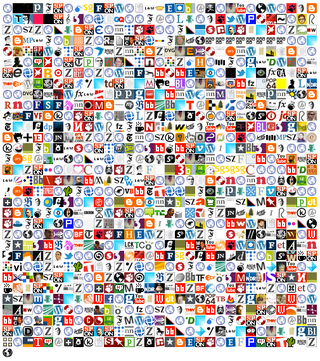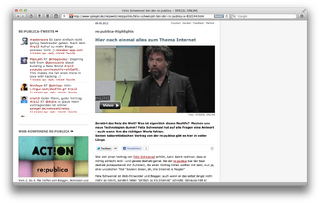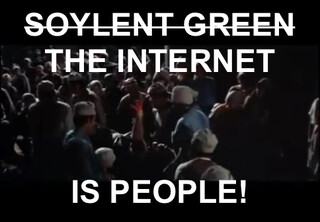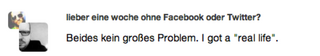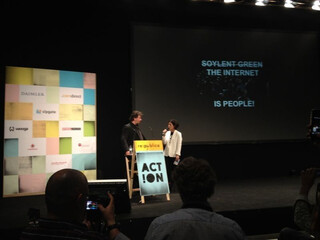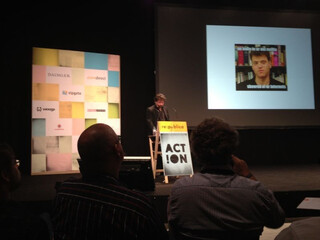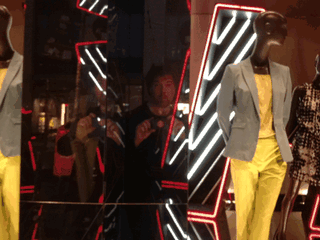abschliessen und zuhören statt lesen
ich habe 1987 meinen highschool-abschluss auf der steilacoom highschool in der nähe von tacoma in washington state gemacht. der highschool-schulabschluss wird in amerika auf zwei arten gefeiert. einmal indem man eine klassenkameradin um ein date fragt, sie zum essen ausführt und danach zur abschlusstanzveranstaltung (prom) fährt, wo auch alle anderen klassenkameraden sind, die ein date gefunden haben.
umgekehrt, dass eine klassenkameradin einen klassenkamerad um ein date fragt, war das zumindest 1987 in steilacoom übrigens verpönt. die männer hatten zu fragen, das blumengesteck, die anfahrt und das essen zu bezahlen. ich wünschte mir damals sehr, dass es umgekehrt gewesen wäre*.
das erste was man auf der abschlusstanzveranstaltung macht ist natürlich ein foto.

in amerika gibt es für niedergelassene fotografen sehr gute förderprogramme. in jeder schule gibt es jährlich mehrere möglichkeiten sich semi-offiziell professionell fotografieren zu lassen. am anfang des schuljahres, gruppenfotos des sportteams oder der clubs in denen man mitglied ist und eben graduation- (abschluss-) und prom-fotos.
neben dem abschlusstanz gibt es auch noch eine abschlussfeier zu der sowohl die lehrer, als auch die eltern eingeladen werden und bei der sich die abschlussschüler billige synthetik-umhänge anziehen und ein quadrat mit bommel auf den kopf setzen. bei der abschlussfeier werden dann die abschlusszeugnisse in einer länglichen zeremonie übergeben, irgendwann die quadrate mit bommel vom kopf genommen und in die luft geworfen und irgendein prominenter hält eine sogenannte commencement speech.
an die commencement speech bei meiner abschlussfeier kann ich mich leider kaum noch erinnern. das kann daran liegen, dass die feier bereits 25 jahre her ist oder dass ich die ganze zeit abgelenkt war. die commencement speech sprecherin war eine nachrichtensprecherin eines lokalen fernsehsenders und ich wunderte mich die ganze zeit darüber, wie nachrichtensprecher es schaffen, sich jederzeit wie nachrichtensprecher anzuhören wenn sie sprechen.
ich habe noch ein VHS-tape von der veranstaltung. im NTSC-format. ich glaube vor 10 jahren hatte ich in während des studiums mal die möglichkeit den film zu sehen. ich kann mich aber an nichts erinnern.
commencement speeches sind im netz auch viel besser aufgehoben als auf VHS-bändern. ein klassiker ist natürlich steve jobs commencement speech in stanford, die er 2005 hielt und die seitdem mindestens sechs schrillionen mal angesehen wurde. warum commencement speeches so grandios sind, wird bei steve jobs rede ziemlich deutlich:
jemand redet ausschliesslich von sich und seinem leben — und dann eben doch nicht, sondern vom künftigen leben und den potenzialen die in den zuschauern stecken.
ein oft prominenter und zumindest in irgendeiner form irre erfolgreicher mensch redet von seinen erfolgen und den grossartigen dingen die er erreicht hat — und dann eben doch nicht, sondern von seinem scheitern und seinen zweifeln und schwächen.
viele commencement speeches lassen sich wahrscheinlich in einem satz zusammenfassen: folgt eurem eigenen weg, hört nicht auf das was euch andere sagen, aber tut etwas sinnvolles.
weshalb ich überhaupt auf dieses commencement-speeches-ding gekommen bin, ist dass ich in den letzten tagen auf zwei reden gestossen bin die mir beide ziemlich gut gefallen haben und deren kontrast zueinander ich ziemlich beeindruckend fand. einerseits habe ich aaron sorkins „commencement address“ vor der diesjährigen abschlussklasse der syracuse universität gesehen, andererseits neil gaimans commencement speech vor der abschlussklasse der „university of the arts“ in philadelphia.
beide reden sind brilliant und ich kann sehr empfehlen, sie anzusehen. und obwohl ich aaron sorkin für einen der besten drehbuchschreiber jemals halte, fand ich es bemerkenswert, wie viel kälter, unsympathischer oder fast misanthropisch sorkin im kontrast zu gaiman wirkt. nein. ich formuliere das nochmal um: obwohl ich sorkin für ziemlich sympathisch und brilliant halte, war ich erstaunt, um wieviel offener, sympathischer und vielleicht auch ehrlicher gaiman wirkte. und während ich das schreibe, fällt mir auch auf warum. sorkin sagt an einer stelle:
You'll meet a lot of people who, to put it simply, don't know what they're talking about. In 1970 a CBS executive famously said that there were four things that we would never, ever see on television: a divorced person, a Jewish person, a person living in New York City and a man with a moustache. By 1980, every show on television was about a divorced Jew who lives in New York City and goes on a blind date with Tom Selleck.
I wish you the quality of friends I have and the quality of colleagues I work with. Baseball players say they don't have to look to see if they hit a home run, they can feel it.
obwohl sorkin vor leuten warnt die keine ahnung haben, macht er in seiner rede deutlich, dass er voll die ahnung hat. gaiman sagt wiederholt (implizit und ich glaube auch explizit), dass er keine ahnung habe wie das mit dem erfolg funktioniere, ausser dass er beobachtet habe, dass es manchmal funktioniert wenn man echt bock auf das hat was man tut. sorkin has it all figured out.
commencement speeches die ich vor einer weile mal gesehen habe und die mir sehr gefallen haben:
- aaron sorkins @ syracuse university (2012)
- neil gaiman @ university of the arts in philadelphia (2012)
- conan o'brien @ dartmouth college (2011)
- jk rowling @ harvard (2008) (teil 2)
- steve jobs @ stanford (2005)
tim pritlove hat kürzlich auf der republica darüber geredet, warum podcasts seiner meinung nach erfolgreich sind. abgesehen davon, dass man sich tim pritloves auftritt auch gut ohne bewegtbild, also nur als podcast anhören kann, hat er glaube ich in fast allem was er sagt sehr recht. vor allem, wenn er erklärt warum wir natürlich lieber hören wie jemand redet (eine rede hält), als das transskript zu lesen. wobei tim allerdings auch ein bisschen verkennt, das gut geschriebene texte durchaus auch ihre qualitäten haben, die mitunter das gesprochene wort meilenweit schlagen können.
so oder so, meine lange-wochenend-erkältung hat mir gelegenheit gegeben fast ebensovielen leuten zuzuhören, wie ich gelesen habe — und ich fand es gut.
*) ich wurde tatsächlich von einer austauschschülerin an einer anderen schule in seattle zum prom-date gefragt. keine ahnung ob das gegen die amerikanischen sitten anno 1987 verstiess. es hat sich auf jeden fall gelohnt zuzusagen, da die prom-feier der schule in seattle in der space needle stattfand und weil ich so noch an ein zweites prom-foto kam.