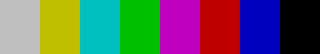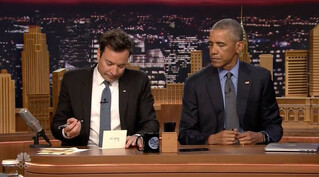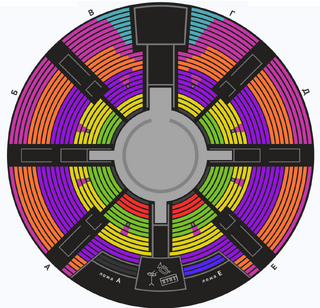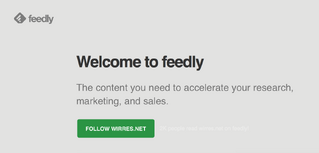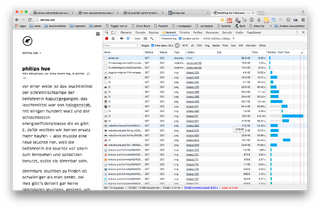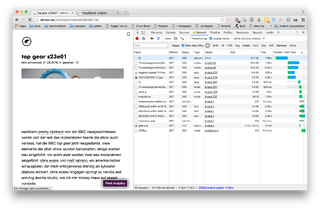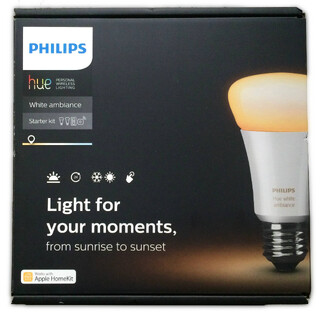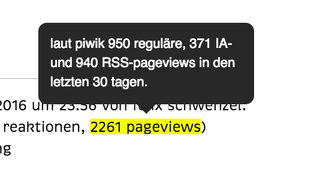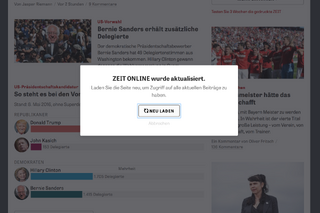die letzten wochen fernsehen waren natürlich von der sechsten staffel game of thrones dominiert. ich habe an dieser staffel nichts auszusetzen gehabt, jede folge erfüllte die erwartungen, die wohl die meisten an die serie hatten: fortführung der vielen erzählstränge, saubere, aufwändige inszenierung, viele überraschende tode und rätsel — und viel raum für spekulationen und diskussionen in den weiten des internets.
ebenfalls alle (meine) erwartungen hat die dritte staffel silicon valley erfüllt, auch wenn diese staffel etwas dunkler ausfiel. wurden in den ersten beiden staffeln die folgen jeweils mit einem versöhnlichen bis happy ende gekrönt, endeten die folgen der dritten staffel auch gerne im totalen chaos und platten cliffhangern. das ändert aber nichts am grundton der serie, der das treiben der technik-blase in und um san francisco enorm überzeichnet und radikal der lächerlichkeit preisgibt und dabei doch stets auf dem boden des vorstellbaren bleibt. ich musste in jeder folge mindesten ein bis zwei mal laut lachen, was ein ziemlich gutes zeichen ist. was mich ein bisschen überraschte ist, dass dan lyons einer der autoren der serie ist. ich hielt dan lyons bisher für einen ziemlichen schwachmaten, mit dessen schreibe und humor ich nicht viel anfangen konnte. aber silicon valley ist in der tat gut geschrieben, gut recherchiert und witzig. und daran dürfte dan lyons einen anteil haben.
im new yorker ist ein wunderbarer artikel über die show und ihre entstehung erschienen. den wandel der show-runner auf dem schmalen grat zwischen fiktion und realität, fasst dieses zitat aus dem artikel gut zusammen:
After the scene aired, viewers complained about the lack of diversity in the audience. Berg recalled, “A friend of mine who works in tech called me and said, ‘Why aren’t there any women? That’s bullshit!’ I said to her, ‘It is bullshit! Unfortunately, we shot that audience footage at the actual TechCrunch Disrupt.’”
der rest des artikel ist lang, aber lesenswert.
ganz schnell durchgerutscht in den letzten beiden monaten, ist die dritte staffel peaky blinders. ich mochte die ersten drei folgen, auch wenn ich ungefähr nichts von dem was dort passierte verstand. die darauf folgenden drei episoden klärten das dann, schlossen ein paar handlungsstränge ab und auch tom hardy darf wieder in andertalb folgen mitspielen. erfreulich finde ich, dass es wohl noch mindestens zwei weitere staffeln gibt, weniger erfreulich fand ich den massiven cliffhanger am ende dieser staffel.
gerade vor ein paar wochen gestartet, und jetzt auch schon um eine staffel verlängert, ist die comic-umsetzung von preacher. preacher hat sich in nur fünf folgen zu einer meiner lieblingsfernsehserien entwickelt. die wilde mischung aus western, revenge-drama, vampir-, superhelden- und mysterygedöns ist überraschend gut gelungen. mir gefallen die überzeichneten figuren, der humor und dass ich, weil ich die comics nicht kenne, überhaupt keine ahnung habe, wohin sich die geschichte entwickelt. zum ersten mal seit breaking bad habe ich (ein kleinwenig) das gefühl, dass ich eine serie gucke, die bereits in der ersten staffel ihren zentralen protagonisten verlieren könnte. wenn die serie auf diesem niveau und diesem look’n’feel weitermacht, gucke ich gerne 10 staffeln davon.
die zweite staffel wayward pines nervt ein bisschen, so wie ich das nach dem piloten hervorgesehen habe. auch der handlungsverlauf war relativ vorhersehbar — und trotzdem guck ich die serie noch weiter. je länger ich die serie gucke, desto unglaubwürdiger, löchriger und absurder kommt mir die ganze geschichte vor. die serie hält sich auch nicht lange mit widersprüchen oder der klärung von widersprüchen auf, sondern versucht einfach die geschichte, mit möglichst niedrigen produktionskosten, schnell weiterzuerzählen und voranzutreiben. da stört es dann auch nicht, dass eine expedition, in die angeblich seit ein paar tausend jahren von menschen unberührte natur, auf ein frisch gemähte wiese führt. die behauptung von unberührter, wilder natur muss ausreichen, für die visuelle darstellung reicht das budget eben nicht. ich werd mir den scheiss aber wohl trotzdem weiter ansehen.
ganz schlimm fand ich auch die letzte (fünfte) staffel person of interest. der serie merkte man schon immer das niedrige produktionsbudget an (eine hauptstatistin muss reichen, deutschland kann man auch in new york schnell nachbauen), aber in dieser letzten staffel wurde offensichtlich auch bei den autoren gespart. versprach die serie in den ersten staffeln kluges nachdenken über die implikationen von künstlicher intelligenz, überwachung und das, was uns menschen im kern ausmacht, wurde das in dieser staffel fast vollständig von absurden, mcgyver-esquen handlungssträngen, pseudo-spannenden, durchsichtigen erzählmustern und hanebüchenen dialogen verdeckt. erst in der letzten folge hatte ich das gefühl, dass das autorenteam nicht mehr nur aus praktikanten und fliessband-serien-autoren bestand.
es ist immer schwer, serien befriedigend zu ende zu führen und in ansätzen gelang es der serie den künstlich hochgepushten konflikt zwischen gut und böse wieder einigermassen einzukochen — wäre da bloss nicht die absurde zwangsstörung amerikanischer produktionen, jedem scheiss auch noch ein happy-end-krönchen aufzusetzen.
ganz schlimm auch in diesem jahr: the last ship. bereits die erste staffel war eine grässliche, pathostriefende idealisierung von militärischer disziplin, gehorsam und kameradschaft. eine serie, die sich anfühlte als sei der writers room im pentagon untergebracht. und trotzdem habe ich mir den scheiss gerne angesehen. denn auch wenn die serie sich anfühlt wie ein rekrutierungsvideo der US-marine, ist das erzählmuster dem von star-trek gar nicht mal so unähnlich: ein (raum-) schiff, gestrandet in einer (potenziell) feindseligen, menschenleeren welt, in der superschurken, unsichtbare kräfte und gewalten nicht nur die mannschaft gefährden, sondern die gesamte (verbliebene) menschheit. die lösung in star-trek, oder hier in in the last ship, liegt stets in einer starken führungspersönlichkeit, die sich auf ihre disziplinierte, gehorsame mannschaft verlassen kann. bei star-trek ist das abstraktionslevel etwas grösser um diese militär-logik erträglich zu machen, bei serien wie the last ship — oder früher bei serien wie JAG, muss man das abstrahieren und distanzieren dann selbst vornehmen.
so grässlich the last ship auch ist, ich schaue es mir gerne an. my guilty pleasure.
was ich von cleverman nach vier folgen halten soll, weiss ich noch nicht so recht. der pilot hatte es mir ziemlich angetan und ich fand auch die darauf folgenden episoden nicht schlecht. aber ich fürchte dass sich die serie einerseits im immer komplexer werdenden handlungssträngenetz verfangen könnte und sie andererseits ihre erdung im immer aufgeblaseneren mystery-gedöns ein bisschen verlieren könnte. trotzdem, bis auf die künstliche körperbehaarung der hairypeople, sauber und aufwändig produziert und nach wie vor sehenswert.
sehr schön wegzusehen ist das britische new blood auf BBC one. eine polizei-serie, deren kriminalfälle, bzw. deren aufklärung sich über zwei bis drei folgen hinzieht und durchgängig unterhaltsam, klug und geerdet gemacht ist. aufhänger für das handlugsgerüst und den serientitel sind zwei begabte neulinge, die sich an ihren vorgesetzten reiben und ständig für ihre unorthodoxen ermittlungsmethoden rechtfertigen müssen. die beiden geben ein prima odd-couple ab und auch wenn der humor sich manchmal ein bisschen 80er-jahre mässig anfühlt, ist das anständige, zeitgemässe krimi-unerhaltung.
graham nortons show ist gerade nach 14 folgen in die sommerpause gegangen und ich habe seit folge acht und neun jede folge angeschaut und erstaunt festgestellt, dass es in wirklich jeder ausgabe mindestens einen fäkalwitz gibt oder jemanden, der davon erzählt, wie er sich mal in die hosen gekackt hat. ich kann jede einzelne ausgabe der show empfehlen. wer alle folgen sehen möchte: sie liegen (fast) alle (noch) auf youtube.
ausserdem weggeguckt wie schokolade: sechs folgen von penn and teller: fool us. die sendung ist immer gleich aufgebaut: jonathan ross, der moderator der sendung, betritt die bühne, macht zwei witze, holt penn und teller auf die bühne, die setzen sich vor die bühne und sehen dann drei zauberern bei einer nummer zu, bevor sie selbst eine nummer aus ihrem bühnenprogram zeigen. der witz der sendung ist, penn und teller mit einer nummer zu täuschen, also einen trick zu zeigen, den sie sich nicht erklären können. leider kennen penn und teller so ungefähr alle tricks der welt, aber hin und wieder bekommt es einer der gäste dann doch hin, etwas zu zeigen, was sich die beiden nicht ohne weiteres erklären können. penn jillette wird dann manchmal ein bisschen aggressiv und unwirsch, aber das ist immer alles höchst unterhaltsam. die tricks werden übrigens nie erklärt, penn deutet zum beweis, dass sie sich nicht haben foolen lassen, immer nur die lösungen an. wer sich ein bisschen mit zaubertricks auskennt, ahnt das ohnehin meistens, aber darum geht es ja auch nicht, sondern es kommt eben immer drauf an, wie unterhaltsam eine nummer ist. und das ist der eigentliche reiz der sendung: man bekommt dort tatsächlich erstklassige und unterhaltsame zauberei zu sehen.
worauf ich mich im juli freue ist natürlich die zweite staffel mr robot (geht am 13. los) und brain dead, die neue serie der the-good-wife-macher robert und michelle king. ken levine hat ein bisschen was darüber geschrieben: BRAINDEAD — My sort of review.