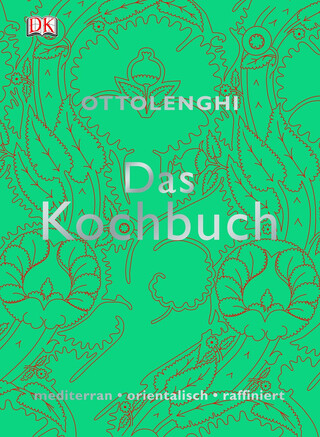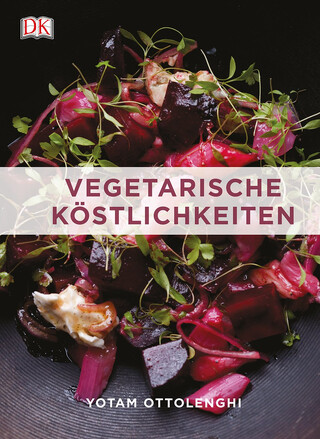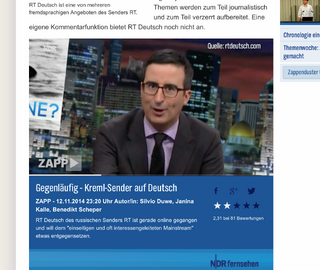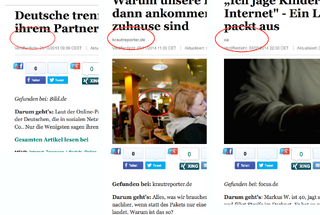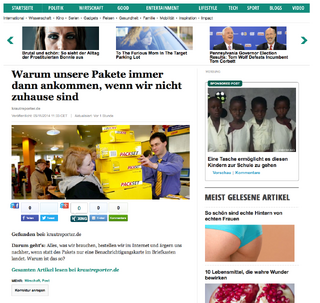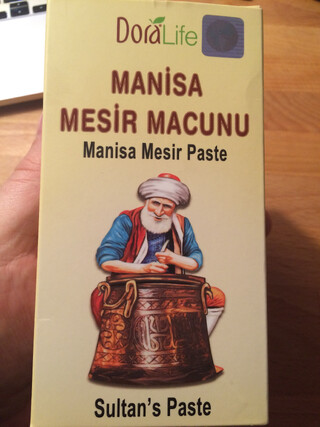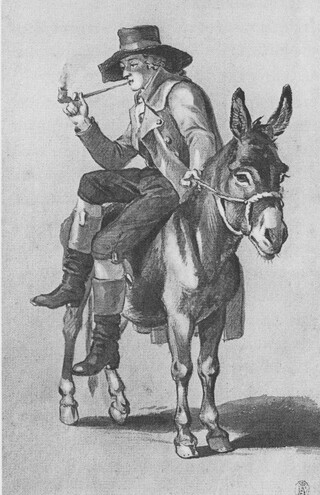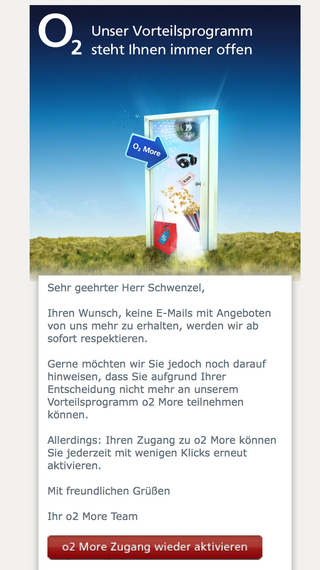ich habe lange über diesen artikel nachgedacht und versuche weiter unten auch, so weit wie mir möglich ist, zu differenzieren. in aller kürze möchte ich aber vorausschicken, dass ich das verhalten von teilen der deutschen blogosphäre, für die ich einst durchaus sympathie aufbringen konnte, extrem zum kotzen finde.
ich tendiere ja durchaus dazu, mich über bestimmte dinge sehr aufzuregen. dabei kommt oft etwas heraus, was andere als unangenehmes „öffentliches bashing“ wahrnehmen. wenn ich dann länger über dinge, über die ich mich aufgeregt habe, nachdenke, stellt sich oft heraus, dass ich zusammenhänge missverstehe, falsch interpretiere, absichten hineinprojeziere oder mich angesprochen fühle, obwohl ich nicht mal ansatzweise gemeint war. distanz ist bei dingen über die man sich aufregt immer von vorteil, aber eben in der aufregung nicht immer möglich. wenn man die perspektive wechselt, sehen viele dinge auch anders aus als aus den eigenen augen und manchmal löst sich die aufregung dann auch einfach in luft auf. ich bin noch nicht sicher, wie ich bei dem, was ich hier beschreibe, schaffen werde distanz aufzubauen.
in dieser woche habe ich mich über mathias winks (auch als mcwinkel bekannt) aufgeregt. auf facebook. mathias hatte das pech, dass sein artikel, in dem er private und intime bilder prominenter frauen veröffentlichte, der erste war den ich sah. es gab und gibt, wie ich später bemerkte, noch einige mehr.
diese bilder wurden ursprünglich, mit einiger krimineller energie, aus den icloud-konten verschiedener frauen gestohlen und an diversen stellen im internet veröffentlicht. im internet herrschte ungewöhnliche einhelligkeit darüber, dass diese bilder nicht gezeigt werden sollten. sie tauchten nicht in mainstream-medien auf, selbst die einschlägigen gossip- und schadenfreude-seiten hielten sich zurück, wohl auch, weil einige vertreter der betroffenen frauen eine kompromisslose juristische verfolgung von medien ankündigten, die diese bilder veröffentlichten.
die hintergründe dieser „leaks¹“ und warum die veröffentlichung dieser privaten bilder eine schweinerei ist, hat vor ein paar wochen jürgen geuter sehr schlüssig erklärt:
Das Verbrechen der Accountcracker mit Urheberrecht oder anderen datenverwandten rechtlichen Konstrukten zu bewerten ignoriert völlig den Schaden an der Person, der hier ganz bewußt wenn nicht intendiert, dann doch böswillig in Kauf genommen wurde. Die Daten lagen hinter diversen Sicherheitsschranken und waren offensichtlich nicht für die Öffentlichkeit oder einen Teil dieser vorgesehen. Alle diese Schranken, alle diese expliziten „Neins“ wurden ignoriert. Das Verbrechen, mit dem man diese „Hacks“ vergleichen kann ist die Körperverletzung und - in diesem Falle in dem es um Nacktbilder ging - der sexuelle Übergriff.
warum veröffentlichte mathias winks nun diese bilder, die nicht nur nach jürgen geuters meinung einen sexuellen übergriff darstellen und die privatshäre dieser frauen verletzen?
weil irgendwelche leute in den bildern rumgekritzelt haben und das gekritzel zu kunst erklärt haben. mathias winks begründet die zurschaustellung der bilder auf seinem blog wie folgt (ich verlinke die quelle nicht):
Das Fappening wird ganz sicher nicht an Euch vorbeigegangen sein, hier [link entfernt] hatte ich bereits drüber gesprochen. Seit ein paar Tagen gibt es nun einen Grund, das Internet noch mehr zu lieben: unterschiedliche Künstler haben die Celebrity Nacktpics jetzt nicht nur entschärft, sie haben Kunstwerke aus ihnen gemacht und sammeln diese im Unfappening-tumblr. Wer die Original-Bilder bis jetzt noch nicht gesehen hat, der sollte auch nicht weiter recherchieren – das hier ist wayyyyy better:
The fappening happened. We can’t change that. But we can cover it up. It’s the least we can do. Here we show the works of artists who did so.
(mir hat man in köln mal mein auto aufgebrochen und meine damaligen habseligkeiten in der umgebung drapiert: auf bäume und in maschendrahtzäune gehängt. mathias winks hätte die kleinen kunst-installationen der kölner sicher geliebt und das viel, viel besser gefunden als wenn die typen meine klamotten einfach selbst benutzt hätten.)
rené walter erklärt auf seinem blog ähnlich euphorisch wie grossartig geklaute und verletzende dinge sein können, wenn irgendjemand das wort „kunst“ benutzt (ich verlinke die zitatquelle hier auch nicht):
Illustratoren malen auf den geleakten Nackedeibildern rum. Großartig! Und ich finde, es sollte viel mehr bunt angemalte Hacks geben. Wenn bei dem ganzen Drama am Ende dann noch Kunst bei rauskommt, dann hatte das ganze immerhin irgendwas gutes.
The fappening happened. We can’t change that. But we can cover it up. It’s the least we can do. Here we show the works of artists who did so.
es ist also die kunst, die es diesen (und vielen anderen) bloggern und wahrscheinlich auch anderen medien jetzt (vermeintlich) ermöglicht intime und private bilder prominenter frauen zu zeigen, weiterzuverbreiten und jovial zu kommentieren?
ich habe eine ganze weile gebraucht um zu begreifen, dass mathias winks und rené walter glauben könnten, sie täten hier etwas gutes. in meiner anfänglichen wut, die ich ins facebook kippte, unterstellte ich mathias winks mangelnden anstand und fehlende empathie gegenüber den opfern der sexuellen übergriffe. dass ein mensch, der noch bei allen sinnen ist, glauben könnte, dass übermalte, aufgehübschte, „entschärfte“ intime und private bilder jetzt nicht mehr die würde oder die privatshäre der prominenten frauen verletzen würde, hielt ich nicht für möglich.
nach ein paar tagen des nachdenkens, halte ich es tatsächlich für möglich, dass manche blogger glauben, dass ein paar pinselstriche aus etwas verletzendem, übergriffigen und für die betreffenden extrem unangenehmen etwas schönes, angenehmes und wohliges machen könnten. aus meiner sicht ist diese haltung zwar vollkommen merkbefreitheit, aber immerhin ist das eine mögliche erklärung.
warum das zeigen der verfremdeten bilder, euphemistisch auch „unfappening“ genannt, völlig merkbefreit ist, erklärt jürgen geuter wieder am besten:
Nun werden unter dem Schlagwort „unfappening“ von Künstlern veränderte Versionen dieser Bilder verbreitet: Über die nackten Körper der Frauen sind amateurhaft Kleidungsstücke gepinselt. Ich halte die Veröffentlichung dieser veränderten Bilder für ähnlich widerlich, wie die Publikation der Originalversionen.
Denn natürlich wird die nackte Version immer mitgedacht. Man profitiert so also noch ein weiteres mal vom Leid der Opfer des Übergriffes und jazzt seine Clickzahlen hoch. Des Weiteren sind die Bilder immer noch nicht – auch nicht in ihrer veränderten Form – von den Frauen zur Publikation freigegeben. Sie werden also weiterhin als Objekt behandelt, ohne Agency und Rechte.
er findet die veröffentlichung der bilder „widerlich“ — wie ich finde, zu recht.
der blogger perez hilton hat vor jahren einiges an berühmtheit mit seinem gossip-blog erreicht. er nutzte auf seinem blog ausgiebig paparazzi-bilder und kritzelte kommentare hinein, um mit diesem kniff lizenzzahlungen aus dem weg zu gehen: er erklärte die mit seinen kritzeleien versehenen bilder einfach zu kunst. nach dieser logik könnte man jetzt auch snuff-filme oder bilder mit extremer gewaltdarstellung zeigen, wenn man sie nur ein bisschen „entschärft“ oder smilies reinmalt. man könnte fotos von obduktionen oder unfallopfern zeigen, wenn man ein paar blümchen reinphotoshoppt. boulevardmedien könnten die gestohlene krankenakte von michael schumacher zeigen, wenn vorher ein illustrator ein paar ornamente aufs papier zaubert. man könnte die fotos von flugzeugabsturzopfern aus facebook zusammenklauben, ein bisschen „illustrieren“ und dann einen artikel mit diesen fotos in sein blog packen und zum beispiel so anteasern:
Illustratoren malen auf den Facebookprofilbildern der Absturzopfer von Air France Flug 447 rum. Großartig! Es sollte sowieso und überhaupt viel mehr bunt angemalte Opferbilder geben. Wenn bei dem ganzen Drama am Ende dann noch Kunst bei rauskommt, dann hatte das ganze immerhin irgendwas gutes.
das leid der opfer und die würde der abgebildeten haben sich nach dieser logik der kunst unterzuordnen. das dachte sich vor einer weile auch ein amerikanischer wurzelsepp, der kurz nach dem #celebleak ankündigte, eine ausstellung der entwendeten nacktbilder zu organiseren. das wurde mitllerweile wieder abgeblasen, zeigt aber die haltung die hinter einem solchen kunstverständnis steckt: kunst als gelebte rücksichtslosigkeit und selbstdarstellungszwang auf kosten anderer.
oder anders gesagt: , die vor allem durch hemmungslosigkeit, eine ausgeprägte egalhaltung, sensationsgier und me2-viral-wellen-reiten besticht. oder um das milder auszudrücken, die angst eine virale welle zu verpassen — und damit besucher- und werbeumsatzrückgänge zu verkraften — scheint bei einigen bloggern die fähigkeit nachzudenken beschädigt zu haben — und ihnen die gleichen beruflich bedingten haltungsdeformationen wie boulevardjournalisten zugefügt zu haben.
ich weiss nicht ob dieser artikel jetzt wirklich differenziert geworden ist. wahrscheinlich eher nicht. ich könnte den bloggern, die die #unfappening-bilder veröffentlicht haben, auch, statt profitgier und aufmerksamkeitssucht, guten willen unterstellen. mir gelingt es aber einfach nicht zu verstehen, wie man bilder zeigen kann, die die darauf abgebildeten nicht veröffentlicht sehen wollen. mir gelingt es auch nicht das mit verschiedenen „schamgrenzen“ zu erklären, da es bei der intimshäre von menschen nicht ausschliesslich um primäre oder sekundäre geschlechtsmerkmale geht. ich verstehe einfach nicht, warum eine übermalte persönlichkeitsrechtsverletzung besser als das original sein soll — oder warum das „großartig!“ sein soll. aber vielleicht kann mir das ja jemand erklären.
1) wer das wort „leaks“ für diese angriffe benutzt müsste über sein gestohlenes fahrrad eigentlich auch als geleakten besitz reden.
bildquelle
[nachtrag 28.09.2014, kurz vor eins]
sascha lobo findet meine vermutung, dass das „arschige“ verhalten von einigen bloggern mit der professionalisierung zu tun haben könnte abwegig. möglicherweise hat er da recht, unter anderem weil er leider meisten recht hat, wenn wir verschiedener meinung sind. unter anderem sagt er:
Die Professionalisierung macht niemandem zum Arsch, der nicht schon vorher einer war. Sie macht es bloß einfacher sichtbar.
dass man bei der professionalisierung genaugenommen differenzieren muss, nämlich einerseits dass man als profi jemanden bezeichnet der besonders gute arbeit liefert und andereseits auch jemanden bezeichnet, der von seiner arbeit lebt, darauf weist christoph boecken im gleichen strang hin.
ob mein artikel aber besser mit „schrankenlose aufmerksamkeitsgier führt möglicherweise zu haltungsschäden und merkbefreiung“ — darüber schlafe ich jetzt nochmal eine nacht.
[nachtrag 12.10.2014]
heute nacht hat mir mathias winks auf facebook eine nachricht geschickt, in der er mir mitteilte, dass er den artikel zum „unfappening“ „rausgenommen“ hätte.