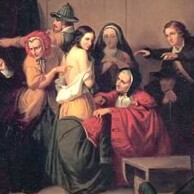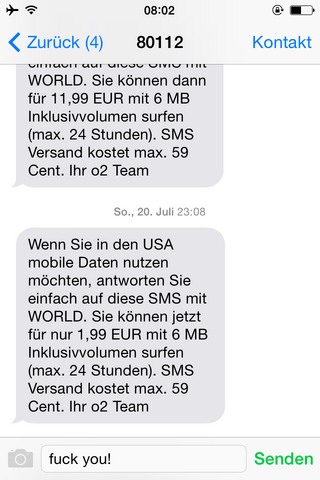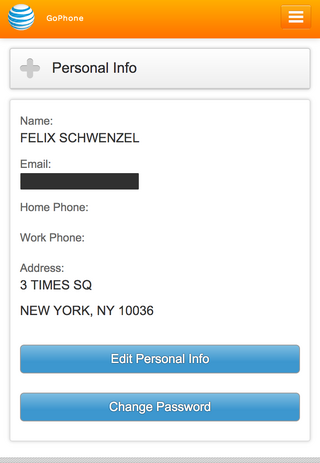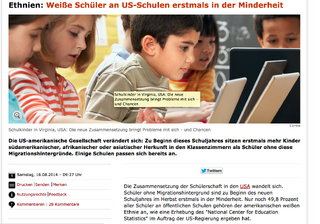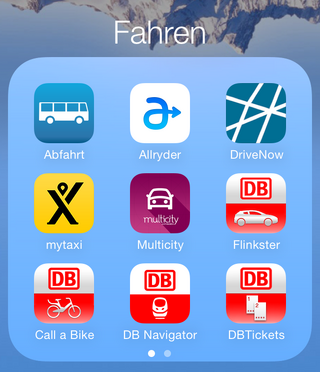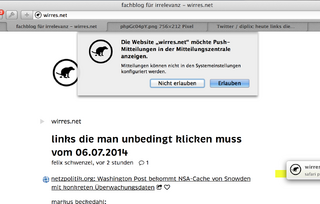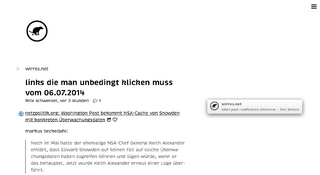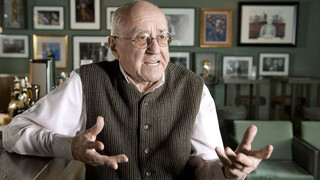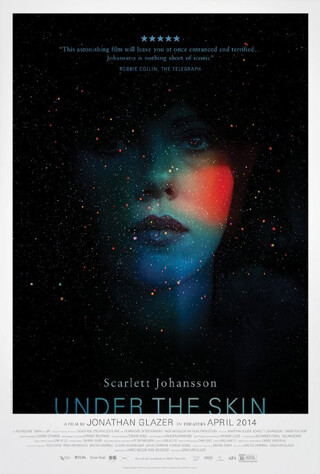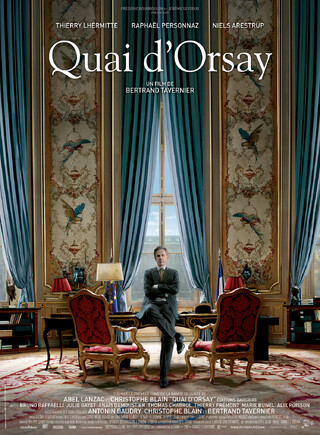links sammeln, veröffenlichen und verdauen
weil friedemann karig fragt, was man mit texten (bzw. links) die „lesenswert“ seien machen könne:
Hmhm. Was tun mit Texten, die lesenswert sind, sei es weil gut oder schlecht, und zu denen man Kommentare hat? Öde Linkliste? Alternative?
— Friedemann Karig (@f_karig) 7. September 2014
die antwort lautet natürlich, ganz allgeimein: ins internet schreiben. am besten natürlich in sowas wie ein blog, weil dann kann man sie abonnieren, wenn man möchte. ich finde es schadet auch nicht, leseempfehlungen zu vertwittern oder auf facebook zu posten, wobei ich finde das dort links oft zu schnell im rauschen untergehen oder, unter umständen, die nur facebook kennt, weggerechnet werden. stehen die leseempfehlungen in einem blog, sind die chancen, dass ich sie finde und lese um einiges grösser. andererseits sendet man durchs twittern oder facebooken ein maschinenlesbares, bzw. per API auslesabres signal, das wiederum aggregatoren wie rivva nutzen können. aber das funktioniert mit einem verweis in einem blog ja auch.
besonders schön ist natürlich, wenn man links nicht nur sammelt und aussiebt, sondern auch eine kleine oder grosse anmerkung dazu schreibt. john gruber macht das seit vielen jahren. er kommentiert links manchmal nur mit einem satz, oft mit einem zitat, manchmal auch mit längeren anmerkungen. eigentlich macht jason kottke das auch, boingboing ebenso — wenn man es genau betrachtet machen es die meisten blogger so. und ob jeder link einen eigenen „artikel“ bekommt oder mehrere in einem zusammengefasst werden ist ja auch eher ne formalie. nico brünjes macht das seit einiger zeit relativ regelmässig in sammelform, maximilian buddenbohm macht das sehr regelmässig, anke gröner zu selten (wobei sie sehr regelmässig kommentierte linklisten zu büchern veröffentlicht).
blogs sind meiner meinung nach das optimale format für die empfehlung von lesenswerten texten. welches format man dafür wählt, wieviel mühe man sich damit gibt, wie regelmässig man das macht — meiner meinung ist das egal. hauptsache man macht es. und hauptsache man schreibt etwas dazu, einen kommentar (140 zeichen oder länger, zur not funktioniert auch oft ein „hihi“), ein zitat, eine kurzzusammenfassung oder eine reihe standardvorlagen („super text, ausdrucken“, „will haben“, „wow“, „nicht gelesen, aber tolle überschrift“).
ich mache das mit dem linksammeln und veröffentlichen übrigens aus genau zwei bis drei gründen. da ich eh ständig im netz lese, was relativ zeitaufwändig ist, kann ich einen text der mir gefiel auch mit relativ geringen zeitaufwand als lesenswert kennzeichnen. ich mache das indem ich mit einem bookmarklet einfach ein bookmark bei pinboard anlege und mit dem buchstaben „s“ (wie sharen) verschlagworte. das führt auch dazu, dass der link bei @wirresnet landet.
der zweite grund ist, dass ich nach dem lesen eines textes nicht selten das bedürfnis habe etwas anzumerken. das kann ein einfaches „hihi“ sein, ein ausdruck der bewunderung oder der abneigung oder manchmal auch nur ein besonders tolles zitat aus dem text sein. mit diesem prinzip war quote.fm mal ne weile sehr erfolgreich. viele kommentare oder zitate schreibe ich schon beim anlegen des bookmarks in pinboard dazu. wenn ich auf dem telefon lese, schreibe ich sie allerdings meist nicht dazu, sondern merke sie mir einfach. das klappt trotz meines schlechten gedächnisses ganz gut.
der dritte und wichtigste grund links zu sammeln, kurz zu kommentieren (oder ein zitat rauszuziehen) ist eigentlich gar kein grund, sondern ein zustand: weil ich gerne veröffentliche. oder teile. oder mitteile. oder gerne sehe wie und ob leute auf das was ich veröffentliche reagieren.
so wie sich manche diese frage stellen:
Wenn in einem Wald ein Baum umfällt und niemand ist da der es hört, hat es dann ein Geräusch dabei gegeben?
frage ich mich oft:
habe ich diese anmerkung zu diesem text überhaupt gedacht, wenn ich sie nicht veröffentliche?
der vierte grund links zu sammeln und auszusieben ist übrigens, dass es mir bei der verdauung von themengebieten hilft. oder genauer, beim sammeln und denken. meine blog ist eben auch mein notizzettel. pinboard ist eher eine art kladde in die ich fast alles werfe, aber was im blog landet, habe ich bereits ausgesiebt und damit als wichtig markiert.
auf den ersten blick wirkt es vielleicht, als würde das sammeln, sieben und veröffentlichen viel arbeit machen. der zweite blick zeigt, das stimmt. aber das macht nichts, denn wie mit allem was man mit einer gewissen regelmässigkeit macht, schleicht sich auch beim linksammeln und veröffentlichen nach einer weile eine gewisse routine ein — dank der man den aufwand dann gar nicht mehr wahrnimmt. was ich sagen will: man muss es einfach machen und wenn man es dann ne weile macht, merkt man, auf welche art es einem am leichtesten fällt — und man merkt irgendwann auch, dass es einem selbst beim denken und zusammenhalten von zitaten und bemerkenswerten texten hilft.
technisch gibt es eigentlich kaum hürden: wer ein wordpress am laufen hat kann entweder das wordpress „Press This“-Bookmarklet nutzen oder (je nach verwendetem theme) kann man mit ein paar klicks einen beitrag mit der beitragsvorlage „link“ erstellen, mit postalicious oder feedwordpress kann man die erstellung von linklisten oder linkartikeln ganz oder halb automatisieren. oder man bastelt sich eine artikelvorlage selbst, mit der man einmal pro woche (oder öfter) einen artikel aus den gesammelten links zusammenstöpselt. auch hier gilt, wei bei fast allem im leben: man muss einfach anfangen, ein bisschen rumprobieren und dann kommt der appetit von ganz alleine.
[nachtrag 08.09.2014]
friedemann karig hat eine sehr schöne kommentierte linkliste veröffentlicht. gerne wieder. /@f_karig