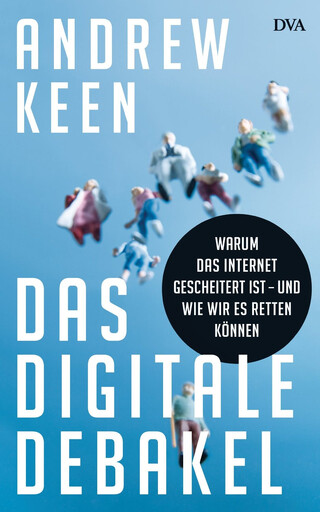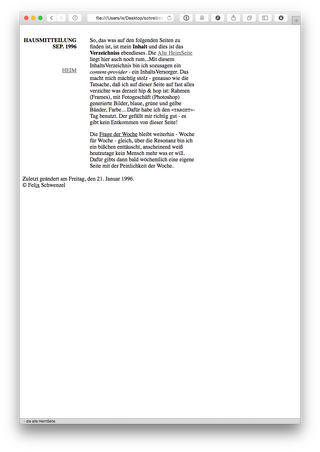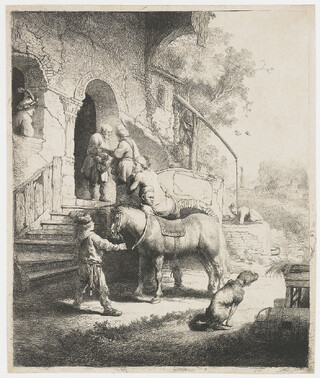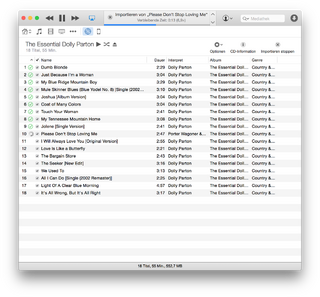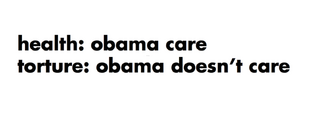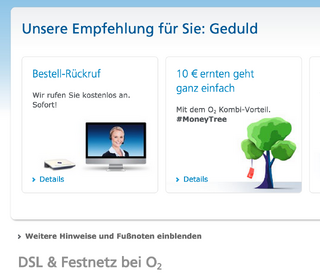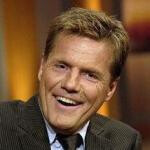in der danksagung am ende seines neuen buches beschreibt andrew keen, wie ihn der atlantic-books-chef toby mundy überredete ein buch zu schreiben, in dem er seine „Überlegungen zum Internet“ zusammenfassen solle:
»Es ist ganz einfach«, versprach er mir. »Schreib einfach alles auf, was du über das Internet denkst.«
keen hat das tatsächlich gemacht und man kann das auch relativ kurz zusammenfassen: er denkt über das internet nicht viel gutes. das internet, schreibt er einmal in einem nebensatz, habe zwar ein paar gute seiten, sei unterm strich aber eine „Riesen-Scheiss-Pleite“. die „Riesen-Scheiss-Pleite“ ist eigentlich ein zitat, das er in kapitel 8 einem „ungekämmten und unrasierten Jungen“, der auf einer konfernez neben ihm sass, in den mund legt. im original lautete das zitat wahrscheinlich „epic fucking fail“. keen greift dieses zitat auf den folgenden seiten (oder im buch-promo-material) wieder auf, um zu beschreiben was er über das internet denkt.
keen wollte das buch ursprünglich auch „epic fail“ nennen, nannte es dann im original dann aber „the internet is not the answer“. auf deutsch entschied sich die deutsche verlags-anstalt dann für den epischen titel: „Das digitale Debakel: Warum das Internet gescheitert ist - und wie wir es retten können“.
der deutsche titel ist verständlicherweise etwas auf randale gebürstet. nach der verleihung des friedenspreises des deutschen buchhandels an jaron lanier erwartet der verlag offenbar zu recht, dass die internet-kritischen deutschen intellektuellen und feuilletons neue nahrung brauchen. um ganz sicher zu gehen, dass die zielgruppe das buch auch als internetkritisch erkennt, hat man das buch dann gleich auf dem cover in 14 worten zusammengefasst.
auch beim umschlagtext übertrieb man zur sicherheit gleich ein bisschen und sagt über keen:
Er lehrte an mehreren US-amerikanischen Universitäten und gründete 1995 ein erfolgreiches Internetunternehmen im Silicon Valley.
im buch schreibt keen auf seite 226 das gegenteil:
Während Kalanick in den Neunzigern mit Scour scheiterte, scheiterte ich mit meinem eigenen Musik-Start-Up AudioCafe.
um die einleitung von keens buch zu lesen, habe ich mehrere anläufe gebraucht. texte in denen mehr rumbehauptet als argumentiert wird, verlieren ganz schnell mein interesse. nachdem er 5 seiten auf michael und xochi birch und deren battery-club rumhackt, füllt er die restlichen 7 einleitungsseiten mit allgemeinem internet-gemäkel, das der verlag im promotion-material auf diesen absatz zusammengedampft hat:
Nicht die Gesellschaft profitiert von einer „hypervernetzten“ Welt, sondern eine elitäre Gruppe junger weißer Männer. Was ihnen immer mehr Reichtum beschert, macht uns in vielerlei Hinsicht ärmer. Das Internet vernichtet Arbeitsplätze, unterbindet den Wettbewerb und befördert Intoleranz und Voyeurismus. Es ist kein Ort der Freiheit, sondern ein Überwachungsapparat, dem wir kosten- und bedenkenlos zuarbeiten. Kurzum: Das Internet ist ein wirtschaftliches, kulturelles und gesellschaftliches Debakel.
ganz einfach: schreib einfach auf was du über das internet denkst — zack, ist die einleitung fertig!
ich habe keen ein paar mal live erlebt und gesehen und fand ihn mit seiner schneidenden stimme und brillianten rhetorik immer sehr überzeugend. einer seiner vorträge auf der next-konferenz im jahr 2009 hat mich massgeblich zu meinem vortrag warum das internet scheisse ist inspiriert. aber gerade weil ich keen schätze, hat mich die fehlende tiefe der argumentation in der einleitung besonders genervt.
die folgenden kapitel kommen einer analyse dann schon etwas näher. keen zeichnet die entstehung des internets und des world wide webs nach und hält sich mit dem, was er über das internet denkt, ein bisschen zurück. er zitiert freund und feind und irgendwann beim lesen wird einem klar, dass keen eigentlich gar nicht das internet scheisse findet, sondern den kapitalismus.
Die Spielregeln der New Economy sind daher dieselben wie die der Old Economy — nur mit Aufputschmitteln.
Simon Head vom Institute for Puplic Knowledge an der New York University erklärt, damit sei Amazon zusammen mit Wal-Mart »das unverschämt rücksichtsloseste Unternehmen der Vereinigten Staaten«.
im prinzip erfüllt keen also sascha lobos forderung, keinen quark zu erzählen:
Beschleunigungskritik ohne Kapitalismuskritik ist Quark.
tatsächlich differenziert andrew keen in seinen analyse-kapiteln auch gelegentlich und räumt ein, dass die probleme die das internet verursacht auch schon in der welt ohne internet existierten. aber leider vereinfacht er mitunter auch so sehr, dass das bild, das er zeichnet, mir stellenweise sehr verzerrt erscheint.
in keens weltbild ist das internet am niedergang der kultur schuld. seine lieblingsbeispiele sind der buchhandel und die musikbranche. er beklagt sich sogar darüber, dass es kaum noch vinyl-platten gebe und sieht die schuld im niedergang der musikindustrie nicht nur in piraterie, der „Monopolisierung des Online-Musikmarkts durch Anbieter wie iTunes und Amazon“ (und spotify und youtube und soundcloud [sic!]), sondern auch in einer von ihm persönlich ausgedachten neuen gefahr, der „Tyrannei der übergrossen Auswahl“. störende fakten lässt keen einfach weg. bei ihm liest sich der niedergang der buchbranche wie eine logische folge von amazon:
Im Jahr 2014 gab es rund 3440 im Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisierte Buchläden und damit fast ein Drittel weniger als noch 1999.
keen verliert kein wort darüber, dass ende der neunziger jahre ein brutaler konzentrationsprozess im buchhandel begann, bei dem filialisten wie thalia oder hugendubel aggressiv expandierten. torsten meinicke, ein buchhädler aus hamburg, erinnerte im deutschlandfunk daran, welche probleme in den neunziger jahren auch erkennbar waren:
Es sind zu viele Bücher, wir müssen weniger produzieren. Mit dem Ergebnis, dass bei der nächsten Herbstvorschau die Titelzahl der Neuerscheinungen noch einmal erhöht worden ist. Das hat sehr lange gedauert, bis ein paar Sachen erstmals zurückgefahren wurden.
ganz ohne die hilfe des internets kreierte die buchbranche eine „Tyrannei der übergrossen Auswahl“; 1969 lag die anzahl der neuerscheinungen und neuauflagen bei 35.577, um 40 jahre später, 2007 und 2011, auf rekordwerte von über 96.000 zu steigen. konzentrationsprozesse, „eine Fokussierung des Geschäfts auf immer weniger und schnelllebigere Titel“ (nochmal deutschlandfunk) und viele andere faktoren, sorgen dafür, dass sich die buchbranche seit jahrzehnten in unruhigen gewässern befindet — aber für keen ist die antwort ganz einfach: amazon, internet — die sind schuld.
„Mir persönlich gefällt das, was ich da sehe, nicht.“ andrew keen über instagram, aber eigentlich über das internet.
keen schreckt auch vor unsinnigen behauptungen nicht zurück. basierend auf seiner unbegründeten, einfach in den raum gestellten these, dass „das publikum“ schlechter informiert denn je sei, versteigt er sich zu der gewagten these, dass früher™, als es noch medien gab die „uneingeschränkt vertrauenswürdig“ waren, sogar über kriege wahrheitsgemäss, objektiv und ohne jede propaganda berichtet wurde. das sei jetzt „angesichts der Macht und Popularität der sozialen Medien“ vorbei. plötzlich, wegen des internets, bleibe die wahrheit bei der kriegsberichterstattung auf der strecke.
diese vereinfachungen, zuspitzungen, einseitigkeiten und blödsinnigkeiten, die sich durch das ganze buch ziehen, rauben keens analyse einiges an glaubwürdigkeit und durchschlagkraft. das ist schade, denn vieles an seiner analyse ist natürlich richtig und diskussionswürdig.
die fehlende tiefe der analyse und die teilweise geradezu schlampige aneinanderreihung von begebenheiten, zitaten, beschimpfungen und steilen thesen ist die grösste enttäuchung an keens buch. vielleicht hat sich keen aber auch einfach nicht getraut, das grosse fass aufzumachen, nämlich statt internetkritik gesellschaftskritik zu üben. sogar seine hin und wieder durchscheinende kapitalismuskritik relativiert er mehrfach, offenbar um das fass geschlossen zu halten. er konzentriert sich lieber darauf, „junge weiße“ internetfuzzis wie mark zuckerberg, travis kalanick, eric schmidt oder steve jobs [sic!] (zu recht) anzuprangern — aber verzichtet darauf, die selben strukturellen missstände im finanzsektor, justizsystem oder globalen handel aufzuzeigen. flapsig und vereinfachend ausgedrückt, für andrew keen ist das internet nicht scheisse, weil die welt scheisse ist, sondern das internet ist für ihn scheisse, weil das internet scheisse ist und alles zerstört.
teilweise sind keens auslassungen auch frappierend. über microsoft oder den ehemals elitären „jungen weißen Mann“ bill gates verliert keen nicht ein einziges negatives wort. wenn es um das böse geht, schreibt er immer von der dreierkombination google, apple, facebook — manchmal ergänzt von uber, instagram und twitter. und während er seitenweise über junge, weisse, grosskotzige männer wie zuckerberg, kevin systrom, larry page, travis kalanick schimpft, die sich ihre jeweils ungefähr 30 milliarden dollar privatvermögen aus „unserer Arbeit, unserer Produktivität“ zusammengeklaubt hätten, erwähnt er menschen wie craig newmark gar nicht. der hat zwar auch, wie die vorher genannten, eine ganze branche zerstört, aber sich daran nicht „grosskotzig“ bereichert. das passt keen dann einfach nicht ins narrativ von der „einen elitäre Gruppe junger weißer Männer“ und so lässt er es einfach aus.
keen redet auch unablässig vom niedergang der kultur, vor allem wegen des von ihm festgestellten absurden kult um amateure, der „Tyrannei der übergrossen Auswahl“, der piraterie und kostenloskultur, vergisst aber zu erwähnen, dass derzeit alle welt zeuge einer renaissance des qualitäts-fernsehens wird, die nicht unwesentlich durch die vernetzung und das internet befeuert wird. keen bietet amanda palmer als zeugin gegen die schlechte bezahlung von künstlern durch spotify auf, erwähnt aber nicht, dass sie eine grosse verfechterin der „kostenlos-“ und „sharing-kultur“ ist, die keen so sehr verachtet und als euphemismen für piraterie versteht.
amanda palmer:
Free Digital Content (and Tits) for Everybody.
andrew keen:
»Kostenlose« Inhalte haben in Wirklichkeit einen unbezahlbaren Preis. Und der Erfolg des Internets ist in Wirklichkeit eine riesige Pleite. Eine Riesen-Scheiß-Pleite.
nochmal zum promo-material des verlags. dort heisst es:
Andrew Keen liefert eine scharfe, pointierte Analyse unserer vernetzten Welt und zeigt, was sich ändern muss, um ein endgültiges Scheitern des Internets zu verhindern.
tatsächlich versucht keen nach 248 seiten die antwort (auf 22 ½ seiten) darauf zu geben, wie man das scheitern des internets verhindern könnte. auch das kann man flott zusammenfassen: regulierung, globale steuern für oligarchen und einen neuen gesellschaftsvertrag an den sich alle halten:
Die Antwort ist, das Internet mit Gesetzen und Verordnungen aus seiner Dauerpubertät zu holen.
»Was für eine Gesellschaft schaffen wir hier eigentlich?«, fragt Jeff Jarvis. Diese Frage sollte am Anfang jedes Gesprächs über das Internet stehen.
das ist nicht falsch, aber auch irre unkonkret. immerhin haben wir das jahr 2015 und nicht nur das internet sollte aus seiner „Dauerpubertät“, in der es sich zweifellos befindet, geholt werden, auch die internetkritik sollte mittlerweile etwas weiter sein, als lediglich „regulierung“ zu rufen oder auf regierungen zu hoffen, die „Google die Stirn bieten“. diese forderungen erhob andrew keen schon, als ich ihn 2009 erstmals sah. dass es auch konkreter und klüger geht, zeigt übrigens ein anderes jüngst erschienes buch: michael seemanns „das neue spiel“. seine analyse ist der von keen sehr ähnlich (allerdings im gegenteil zu keen, ohne häme, gespött und ad-hominem-angriffe aufgeschrieben), aber seine „10 regeln für das neue spiel“ sind konkreter, klüger und differenzierter als keens ganzes buch. aber das, und strategien für den umgang mit dem internet, sind das thema eines eigenen texts, der wahrscheinlich anfang februar im internet erscheint.
nachdem ich das buch gelesen habe, fiel mir ein besserer, passenderer umschlagtext für andrew keens buch ein als das original:
Das Internet hat versagt. Trotz seiner offenen, dezentralen Struktur hat es uns nicht mehr Chancengleichheit und Vielfalt gebracht, im Gegenteil: Es vergrößert die wirtschaftliche und kulturelle Ungleichheit. Der Graben zwischen zwischen einer Handvoll junger weißer Männer, die an Reichtum und Einfluss gewinnen, und dem Rest der Gesellschaft wird immer größer. Bissig und pointiert rechnet Silicon-Valley-Insider Andrew keen mit unserer vernetzten Gesellschaft ab und fordert uns auf, staatlicher Untätigkeit und Internetmonopolisten wie Google und Amazon den Kampf anzusagen.
das ist mein vorschlag:
Das Internet ist nicht gescheitert, wir haben nur noch nicht die richtigen Strategien entwickelt damit umzugehen. Andrew Keen hatte sich fest vorgenommen sich ein paar Strategien auszudenken, es aber in der kürze der Zeit bis zur Drucklegung nicht geschafft sie auszuformulieren. Dafür hat er bissig und pointiert aufgeschrieben, wie das Internet entstanden ist und was er über das Internet denkt.
andere über das buch:
ich habe das buch vom verlag als rezensionsexemplar (als gebundene ausgabe) zur verfügung gestellt bekommen.
★ ☆ ☆ ☆ ☆ (1/5)