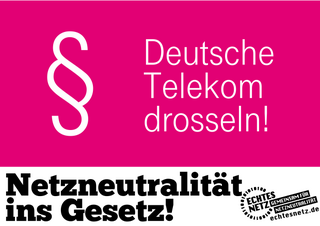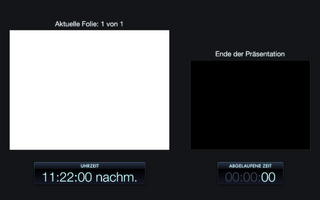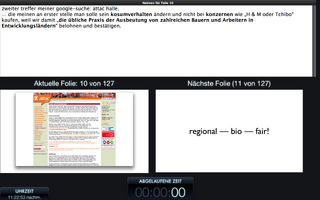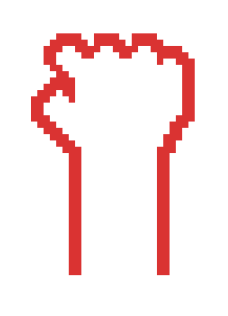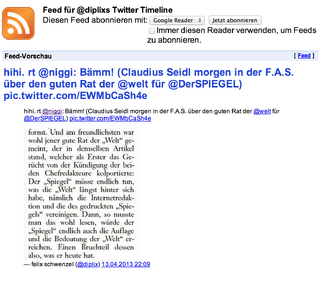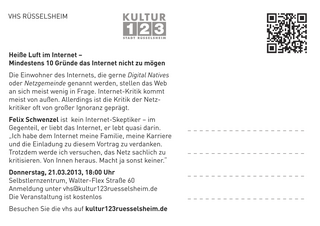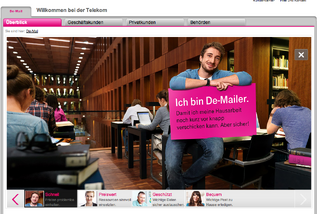ich habe adgefiltert
frank patalong hat mal wieder ins internet geweint. zuletzt hat er das, soweit ich das mitbekommen habe, 2010 auf spiegel online. damals sprach er noch von einem „16 Jahre alte Deal zwischen Online-Medien und Mediennutzern“ der angeblich lautete:
Wir liefern Ihnen kostenfrei Inhalte, und Sie sehen sich dafür im Umfeld Werbung an.
ich habe damals leicht polemisch, aber mit nach wie vor gültigen argumenten geantwortet. damals wunderte ich mich vor allem darüber, dass der deal mit mir gar nicht geschlossen wurde. im gegenteil, den deal den ich gerne mit online-medien abschliessen würde lautet:
wen du willst dass deine leser dich ernstnehmen und unterstützen, musst du sie auch ernst nehmen.
das habe ich, wie gesagt, 2010 geschrieben und ich glaube das mit dem ernstnehmen ist nach wie vor ein problem. alles was patalong zur adblocker diskussion, damals wie heute, einfällt ist publikumsbeschimpfung:
- die leser ignorieren die wirklichkeit (die der verlage, vermute ich mal)
- die leser sind nicht bereit dauerhaft im netz zu zahlen
- die leser sind auch am kiosk nicht mehr bereit zu zahlen
- die leser ertragen noch nichtmal ein „wenig Bling-Bling“
- leser, die fordern werbung weniger störend zu gestalten, sind bescheuert und begriffstutzig
- viele „vor sich hinsalbadernde“ leser waren 1994 noch nicht mal im netz und wagen es jetzt eine institution die es seit 1994 ist, zu kritisieren
- die leser machen alles kaputt
immerhin hat patalong in der aktuellen publikumsbeschimpfung nicht wieder die olle deal-kamelle aufgewärmt. jetzt ist apokalypse angesagt. wie 1983 im spiegel beim waldsterben. da war es zwar ein hiroshima das den deutschen wäldern wegen saurem regen bevorstand, jetzt ist es die apokalypse die den deutschen online-medien (oder wie patalong es ausdrückt: „populären Webseiten“) bevorsteht, wegen werbefiltern.
kurz ein wort zu werbefiltern. ich benutze zwar auch einen werbefilter, aber viele „populäre Webseiten“ sind dadrin auf einer weissen liste. trotzdem sehe ich — auch bei komplett deaktiviertem werbefilter — fast keine werbung. aus dem einfachen grund, dass ich zusätzlich noch ghostery benutze. ghostery filtert anfragen dritter auf webseiten weg. das heisst zum beispiel, dass die facebook- und twitter-buttons die viele betreiber „populärer Webseiten“ in ihre seiten einbauen damit einfach weggefiltert werden. so können weder twitter, noch facebook, aber auch unzählige andere dienste nicht mehr meine wege im netz und mein surf- und klickverhalten verfolgen und auf ihren servern protokollieren.
in einem normalen browserfenster bin ich stets bei facebook, twitter, aber auch, besipielsweise, amazon, pinterest und hinz und kunz angemeldet. das finde ich angenehm, denn so kann ich ohne weitere anmeldung direkt mein facebook, mein amazon oder mein twitter aufrufen, wenn mir danach ist. wonach mir allerdings nicht ist, ist hinz und kunz ohne mein zutun zu erzählen wo ich mich im netz rumtreibe. ich möchte selbst bestimmen wer etwas über mich erfährt und wer nicht. ich bin mit meinen daten überaus grosszügig, was der spiegel im übrigen immer wieder in ellenlangen tiraden anprangert und als extrem dumm darstellt, aber ich möchte die kontrolle behalten. ich möchte die kontrolle nicht an die werbeabteilung oder die vermarkter von „populären Webseiten“ abgeben.
also habe ich ghostery recht undurchlässig konfiguriert. das führt bei manchen amerikanischen oder britischen webseiten dazu, dass auch die anzeige von inhalten nicht mehr funktioniert, weil die betreiber mancher „populärer Webseiten“ nicht nur die auslieferung von werbung an dritte ausgelagert haben, sondern auch die auslieferung von inhalten. in solchen fällen wechsle ich dann in den anonymen browsermodus (im übrigen eine der grossartigsten erfindungen von chrome), in dem weder ghostery, ein adblocker, noch irgendein anderer plugin aktiv ist. aber ich bin im anonymen browserfenster eben auch nicht bei facebook, twitter oder amazon angemeldet.
der spiegelverlag (bzw. einer seiner tochterverlage) war übrigens vor etwa 15 jahren der meinung, dass man mit einem ordentlich gemachten wirtschaftsmagazin kein geld verdienen kann. nach nur drei ausgaben stoppte der spiegelverlag das projekt econy. mittlerweile ist das nachfolgemagazin „brandeins“ auch wirtschaftlich ein knaller. so was fällt mir immer ein, wenn leute andere als ahnungslos, salbadernd oder kurzsichtig argumentierend beschimpfen um ihren vor weisheit strotzenden und innovation berstenden arbeitgeber zu verteidigen.
offensichtlich funktioniert der werbeblocker-sniffer der zeit nicht so toll.

Mit Mutter telefoniert. Sie wollte lernen, wie man #AdBlocker installiert. Hat sie auf Spon gelesen. Gut gemacht @spiegelonline!
13.05.2013 19:14 via Tweetbot for iOS Reply Retweet Favorite

@tristessedeluxe Tillmann Allmer
nochmal zurück zu ghostery, bzw. zum thema, dass die adblocker-diskussion auch eine bugblocker, flashblocker oder sogar javascript-blocker diskussion sein sollte, bzw. eine um datenkraken (übrigens eins der lieblingsthemen des gedruckten spiegels, zumindest wenn es sich um kraken anderer handelt). wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat lediglich die süddeutsche in ihrem bitte-machen-sie-eine-blockierausnahme-für-uns-text auf die tracker-problematik hingewiesen. stefan plöchinger:
Wir haben außerdem in unseren Datenschutzregeln erklärt, wie Sie personalisierte Werbung aussteuern können, falls Sie sich daran stören - auch dies im Sinne von Ihnen, unseren Nutzern.
in den datenschutzregeln der süddeutschen, die ich im übrigen ziemlich beispielhaft finde, wird dann auch tatsächlich in allgemeinverständlichem deutsch auf die tracker-problematik hingewiesen:
Die Kehrseite dieses Vorgehens ist, dass die sozialen Netzwerke faktisch auch Ihr Leseverhalten auf unserer Seite analysieren können - wie auch Ihr Verhalten auf vielen anderen Seiten, denn das Vorgehen ist Marktstandard. Wenn Sie dieses sogenannte Tracking verhindern wollen, müssen Sie sich entweder auf den Plattformen wie Facebook und Google abmelden, wenn Sie unbeobachtet durch das Internet surfen wollen, oder in den Privatmodus Ihres Browsers wechseln.
na gut, dass der hinweis auf blocker wie ghostery fehlt, kann ich nachvollziehen, da ghostery auch den ganzen anderen scheiss blockiert. wie man den ganzen anderen scheiss die webtracker, bugs, cookies ausoptiert, wird über viele absätze hinweg, mit grosser detailliebe in der sz-datenschutzerklärung erklärt:
Mehr Informationen zu nutzungsbasierter Online-Werbung: www.meine-cookies.org. Wenn Sie sie deaktivieren wollen: www.youronlinechoices.com. […] mehr über Ihre Rechte und die Privatsphären-Einstellungen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook. […] Genauere Informationen zu Art, Zweck und Umfang sowie der weiteren Nutzung Ihrer Daten durch Twitter, mehr über Ihre Rechte und die Privatsphären-Einstellungen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Twitter. […] Genauere Informationen zu Art, Zweck und Umfang sowie der weiteren Nutzung Ihrer Daten durch Google, mehr über Ihre Rechte und die Privatsphären-Einstellungen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google. […] Wenn Sie die Datenanalyse verhindern wollen, können Sie dieses Browser-Plugin herunterladen und installieren oder die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser generell deaktivieren. […] Detaillierte Informationen zum Datenschutz der Firma Comscore finden Sie auf dieser Seite. […] Detaillierte Informationen zum Datenschutz bei Chartbeat finden Sie auf dieser Seite. […] Details zum Datenschutz finden Sie bei der Firma Infonline, die für das SZM zuständig ist, und der Datenschutzwebsite der IVW. Sie können die Datenverarbeitung auf dieser Seite unterbinden. Die Reichweiten-Statistiken sind öffentlich hier einsehbar. […] Auch [bei der VG Wort] werden IP-Adressen nur anonymisiert verarbeitet und keine personenbezogenen Daten gespeichert, ein Unterbinden ist derzeit nicht möglich. […]
es folgen noch hinweise zum datenschutz und zur deaktivierung von trackern bei der AGOF, iq digital, google adsense, nugg.ad, und plista. man könnte also, wenn man als nutzer zwei bis drei stunden zeit investiert durchaus viele der tracker die einen auf süddeutsche.de verfolgen und beobachten deaktivieren oder entschärfen. das geht indem man sich die datenschutzbestimmungen der sz und ihrer 15 partner durchliest und dann ebensoviele konfigurationsseiten besucht, die einen cookie setzen und hoch und heilig versprechen, einen nicht mehr zu beobachten. das gleiche kann man dann noch für die anderen „populäre Webseiten“ machen und in zwei bis drei tagen hat man alles hinkonfiguriert.
dass die verlage ghostery nicht erwähnen kann ich nachvollziehen. neben ghostery gibt es noch eine weitere alternative, auf die keine der „populären Webseiten“ die sich an der adblocker-ausnahme-kampagne beteiligt haben hinweist; nämlich auf eine unterstützung der „do not track“ anweisung. das liegt natürlich daran, dass die vielen hundert werbepartner, also datensammler und auswerter mit denen viele „populäre Webseiten“ zusammenarbeiten, diese anweisung offenbar nicht beachten. ich glaube, dass das ein schlüssel sein könnte: weniger, angenehmere und (auf wunsch) die privatsphäre respektierende werbung. adblockplus sieht das in seinen hinweisen auf kriterien akzeptabler werbung“ auch so:
Diese Kriterien sind noch nicht final, wir arbeiten an ihrer Verbesserung. Insbesondere wollen wir vorraussetzen, dass die Privatsphäre der Nutzer respektiert wird (verpflichtende Unterstützung von Do Not Track).
die verachtung die patalong einem teil seiner leser an den kopf wirft ist nicht nur für ihn typisch. was die leser wollen, entscheidet im verlagswesen immer noch der gesetzgeber und die verlagsleitung. keiner der beteiligten verlage hat meines wissen jemals bei seinen lesern nachgefragt welche art von werbung sie aktzeptabel finden. ausser der taz bittet kein verlag um spenden oder finanzielle unterstützung. kein verlag bietet eine werbe- und trackerfreie webversion seiner seiten für abonnenten oder unterstützer.
obwohl: im grunde genommen befragen die verlage ihre nutzer. mit analysesoftware und trackern. so erkennen sie, was ihre leser besonders oft anklicken, was nicht, welche überschriften funktionieren, welche nicht. und sie erkennen, dass die leser so genervt von der geschalteten werbung sind, dass sie sie ausfiltern. redaktionell reagieren die „populären Webseiten“ auf das nutzerverhalten indem sie entsprechende inhaltliche schwerpunkte setzen, kompakter schreiben oder an den überschriften feilen. konsequenzen aus der popularität von werbefiltern sind nicht etwa versuche die werbung akzeptabler zu gestalten, sondern aufrufe die werbung so wie sie ist zu akzeptieren. was akzeptabel ist, bestimmt hier nicht der benutzer, sondern der vermarkter.
ich glaube nicht dass diese haltung langfristig zum erfolg führt.
e13.de: Der AdBlocker Appell (ursprüngliche Fassung) #
kiki hat „den ersten Entwurf des Bettelbriefs“ gefunden.
anmutunddemut.de: Werbung vs. Privatsphäre #
benjamin birkenhake über werbung und tracking:
Das ganze Tracking wird von den Vermarkter und Werbekunden gemacht, weil sie es können und weil bei den Verlagen das nötige Wissen und daher auch das entsprechende Problembewußtsein fehlt. Man unterwirft sich widerstandslos hier halt den Vorgaben der Vermakter. Technisch ist das alles nicht nötig und könnt ohne weitere anders umgesetzt werden. Dann würde die Werbung auch nichteinmal von Ad-Blocker geblockt werden (können).