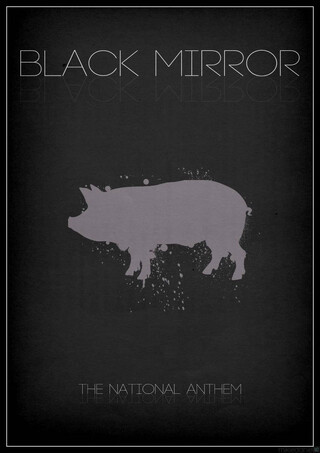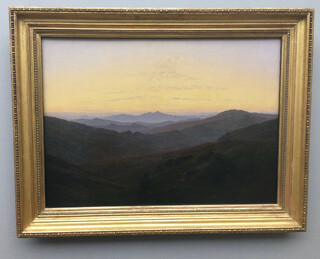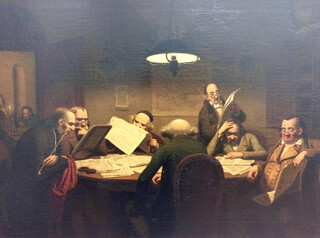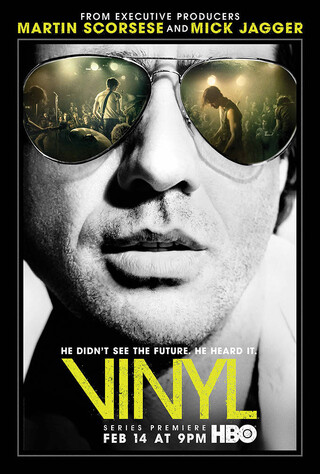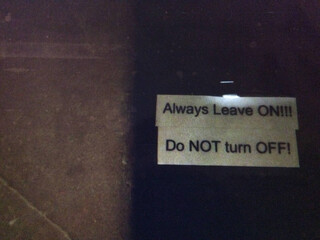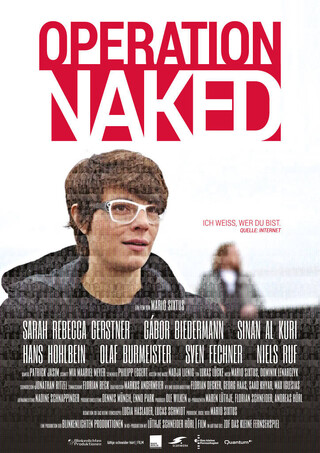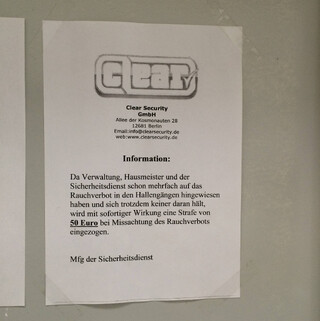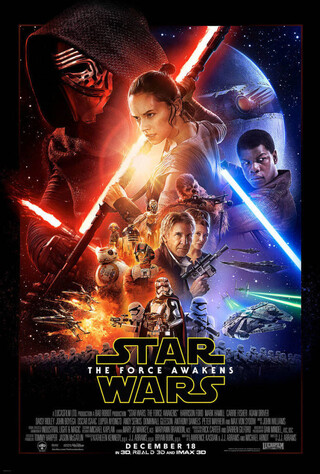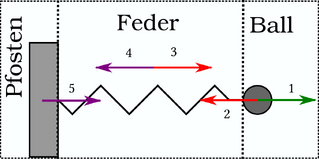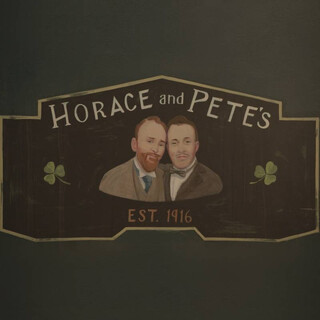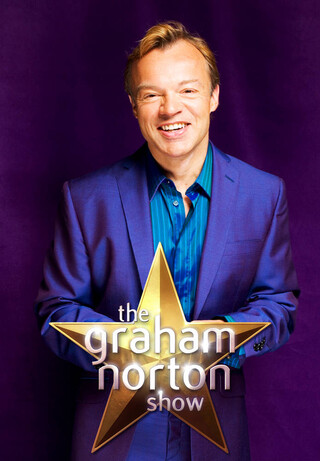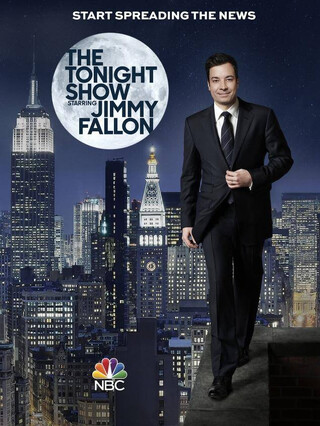Machts doch selber! (t3n 43)

Als ich noch relativ jung war, war ich der festen Überzeugung, dass Altsein das Schrecklichste auf der Welt sei. Alte Menschen schnauzten einen im Bus an, wenn man auf den falschen Plätzen saß, viele meiner Verwandten, die ich immer als sehr alt empfand, kritisierten meine Frisur, die angeblich zu engen Hosen, die ich trug oder wie ich bestimmte Sachen ausdrückte oder tat („das sagt/tut man nicht!“).
Ich fand die meisten alten Menschen in meinem Umfeld zwar nett, aber auch — auf eine Art — bemittleidenswert. Die alte Dame, zu der ich bei uns im Haus immer zum Fernsehen ging (wir hatten damals keinen eigenen Fernseher), war immer alleine, erzählte ständig die gleichen Sachen aus ihrer Jugend und schaute abends Musikantenstadtl.
Mein Eindruck vom Alter war: wer alt ist, versteht die zeitgenössische Welt nicht mehr und tendiert zur Unfreundlichkeit und Besserwisserei.
Dass ich im Übrigen auch nichts verstand und mein Weltbild, wie die meisten (jungen) Menschen, aus anekdotischem Wissen konstruierte, merkte ich eines Abends vor dem (mittlerweile eigenen) Fernseher. Dort wurde ein sehr alter Mann portraitiert. Der alte Mann, ich glaube er war Philosoph, sagte viele sehr kluge Sachen, war aufgeweckt und schnell, ganz anders als die alten Menschen, die ich bisher kannte. Zum ersten Mal sah ich einen alten Menschen, der im Alter offenbar klüger und nicht doofer geworden war und verlor auf einen Schlag meine generische Angst vor dem Altwerden. Ich verstand, dass der Charakter und die Fähigkeiten eines Menschen nicht primär mit dem Alter zusammenhängen.
Bis heute glaube ich, dass ein natürliches Verhältnis zu Technologie, Innovationsfähigkeit oder brennende Neugier keine Frage des Alters sind, sondern der Haltung. Oder anders gesagt: Neugierde und Risikofreude kommen bei neugierigen und risikofreudigen Menschen auch im höheren Alter vor. Abgesehen davon: Unter eklatantem Mangel an Neugier, Unternehmenslust, Risikofreude oder technischem Verständnis leiden auch viele jugendliche Menschen.
Zugegeben, junge Menschen lernen besser und schneller und lassen sich nicht so sehr von Konventionen aufhalten — das aber vor allem, weil sie die Regeln noch nicht gelernt haben und oft über eine gewisse größenwahnsinnige Risikobereitschaft verfügen.
Gesellschaftlich tun wir allerdings alles, um Menschen, egal ob jung oder alt, ihren Größenwahn und ihre Risikofreunde auszutreiben. Gegen den Strom zu schwimmen, Risiken einzugehen, Dinge anders zu machen als bisher, Fehler machen, das ist überall schwer, aber in Deutschland ganz besonders; hier lieben wir den gemeinsamen Nenner und die Risikoabsicherung. Das Schulsystem ist darauf ausgerichtet, der Industrie und dem Mittelstand gut ausgebildeten und angepassten Nachwuchs zu liefern, der sich problemlos in vorhandene Prozesse integrieren lässt. Erfolg messen wir immer noch am liebsten an der Höhe der Gehaltsabrechnung und an der Sicherheit des Jobs.
Würden wir in unserer Gesellschaft das Andersartige, das Ungewohnte oder die Unangepasstheit mehr schätzen und fördern, müssten wir nicht mehr all unsere Hoffnungen darauf setzen, dass die aufbegehrende Jugend es wagt, die Konventionen zu durchbrechen und Neues schafft.
Abgesehen davon haben wir durchaus die Fähigkeit, gelegentlich das Andersartige, Unkonventionelle oder vom Gewohnten Abweichende zu schätzen: sobald etwas so erfolgreich ist, dass es im Mainstream angekommen ist. Neues kann nach dieser Herdenlogik nur gut sein, wenn es alle interessant oder nützlich finden oder es alle Kurven des Gartner Hype-Zyklus durchlaufen hat und in mindestens drei James Bond-Filmen produktplatziert worden ist (siehe auch → Jetpack).
Wir schätzen lediglich das Ende des Weges, obwohl wir gelegentlich auch den Weg selbst wertschätzen sollten, inklusive der unvermeidlichen Misserfolge und Fehltritte. Vor allem sollten wir uns auch hin und wieder selbst auf diesen Weg wagen. Stattdessen projizieren wir den potenziellen Erfolg auf einzelne jugendliche Senkrechtstarter oder vergöttern die, die am Ende des Weges stehen.
Nicht der Weg ist das Ziel, sondern die Aufbruchsfreude.